Donnerstagmorgen, kurz nach halb neun. Die Temperaturen: angenehm, die Luft: klar, Lissabon: in warmes Licht getaucht, der Tejo: schimmert bläulich. Ideale Bedingungen für meine morgendliche Laufrunde.
Zumindest in der Theorie. In der Praxis laufe ich nicht und runde auch nicht. Stattdessen liege ich bäuchlings auf dem Bürgersteig. An der Avenida Infante Dom Henrique, auf Höhe des Fähranlegers Terreiro do Paço, an dem die Pendler von der anderen Uferseite ankommen. Mit blutigen Knien, Ellenbogen sowie schmerzenden Händen.
Also, nicht die Pendler haben aufgeschlagene Knie und Ellenbogen und ihnen schmerzen auch nicht die Hände, sondern mir. Das ist unideal. Nicht nur für morgendliche Laufrunden, sondern in allen Lebenslagen.

Laufen in Lissabon fällt nicht in die Kategorie „vergnügungssteuerpflichtig“. Wenig überraschend bei einer Metropole, die unter anderem den Beinamen „Stadt der sieben Hügel“ trägt. Was die Kurzform ist für „Stadt der sieben Hügel, der tausend Anstiege, der tausend Abstiege sowie zahlreicher Unannehmlichkeiten, wie zum Beispiel glatte Bürgersteige, holpriges Kopfsteinpflaster und nervige Fußgängerampeln“.
Das lernte ich in der zweiten Woche am eigenen Leib kennen. Da ging ich zum Joggen in den Parque Eduardo VII. Eine Empfehlung der Website „Great Runs“. Eröffnet wurde der Park Anfang des 20. Jahrhunderts unter dem Namen Parque Liberdade (Freiheitspark) und kurz danach umbenannt nach dem englischen König. Aus Dankbarkeit für dessen Besuch und weil sich Portugal bei den Engländern einschleimen wollte.
Mit fast 26 Hektar – das sind ungefähr 37 Fußballfelder oder das halbe Saarland – ist er der größte innerstädtische Park Lissabons. Die „Great Run“-Kollegen priesen die großartige Aussicht an, außerdem gäbe es einen See, ein Gewächshaus und ein Restaurant. Obendrein steht dort die größte Fahne Portugals rum. Was willst du mehr für eine morgendliche Laufeinheit?
Eher beiläufig und fast schon verniedlichend erwähnen die „Great Runner“, der Park sei „hilly“. In der Realität musst du auf der einen Seite steil hoch und auf der anderen Seite steil runter rennen. Jeweils mehrere hundert Meter.
Nach einer Runde stellte ich fest, dass ich lediglich einen Kilometer zurückgelegt hatte. Für gewöhnlich laufe ich zehn bis elf Kilometer, am Wochenende auch mal zwanzig plus. Das heißt, ich müsste den Park zehn-bis elfmal umrunden, am Wochenende mindestens zwanzigmal.
Als die Kinder klein waren, schaute ich 137-mal hintereinander die Lauras-Stern-Folge „Das Turbobaby“ an. Seitdem kann ich sehr gut Wiederholungen, Langeweile und Stumpfsinn ertragen. Aber mir drei Monate fast täglich einen Parkrunden-Drehwurm beim Parkumrunden einzuhandeln, darauf hatte mich nicht einmal das Turbobaby vorbereitet.
Die Aussicht vom höchsten Punkt des Parks ist allerdings tatsächlich phänomenal. Du schaust über die komplette Anlage mit den symmetrisch angeordneten Hecken, die riesige Marques-de-Pombal-Statue, die Avenida Liberdade, die Baixa, bis zum Fluss.
Und das Beste: Während du den Panoramablick genießt, legst du eine kleine Pause ein.

Auf der Suche nach einer besseren Laufstrecke stieß ich auf Monsanto. Nicht das Düngemittel, sondern ein Waldgebiet am westlichen Stadtrand Lissabons.
Der Monsanto-Park umfasst circa 900 Hektar – das sind fast 1.300 Fußballfelder beziehungsweise 17-mal das Saarland – und ist damit die größte Grünfläche in Lissabon, die grüne Lunge der Stadt. Sportanlagen, Picknickplätze, Aussichtspunkte und ein Campingplatz bieten Möglichkeiten der körperlichen Ertüchtigung und der Erholung. Zudem führt ein Rennparcours durch Monsanto, auf dem 1959 ein Formel1-Rennen stattfand, was den Erholungswert wahrscheinlich ein wenig schmälerte.
Um Monsanto zu erreichen, musste ich zunächst steil hoch laufen – natürlich –, dann steil hinunter – was auch sonst. Das bereitete mich gut auf die weitere Parkrunde vor, die sich durch viele Wellen, Buckel und Hügel auszeichnete. Sehr viele Wellen, Buckel und Hügel. Ständig und immer wieder. Eigentlich ist der Park ein einziges auf und ab.
Damit du nicht ziellos durch Monsanto irrst, sind die Wander- und Laufrouten farblich markiert. Allerdings wurde an den Wegweisern gespart, so dass du dich an mehr als einer Abzweigung fragst, ob du nun nach links oder rechts musst.
Dazu kommt, dass die Farben für den blauen und den hellblauen Weg nur um Nuancen voneinander abweichen, die für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar sind. Dafür unterscheidet sich aber die Länge der Strecken um mehrere Kilometer. Was dazu führen kann, dass du deine morgendliche Laufrunde ungewollt von zehn auf fünfzehn Kilometer verlängerst.
Dafür ist Monsanto sehr waldig. Mit Eukalypten, Eichen und Pinien. (Habe ich im Internet nachgelesen. Als Stadtmensch erkenne ich höchstens mit Mühe eine Birke und eine Kastanie.) Fast schon romantisch ist das. Ohne Autos, Verkehrslärm und morgens mit wenigen Menschen.

Außerdem stieß ich beim falsch Abbiegen zufällig auf eine Ansammlung putziger Holzfiguren, die gute Laune machen. Bis du dich dann den nächsten Hügel hochquälen musst.
Schließlich fand ich doch noch eine Route mit lauffreundlicherem Streckenprofil. Die Avenida Liberdade, in deren Nähe wir wohnen, ist – für Lissaboner Verhältnisse – relativ eben und führt dich Richtung Fluss und dort kannst du geradezu idyllisch an der Promenade entlangjoggen.
Heute früh startete ich mit der monströs-phallischen Marquês-de-Pombal-Statue im Rücken, dann ging es die Lissabonner Pracht- und Prunkmeile hinunter. Vorbei an den Luxusläden von Prada, Louis Vuitton oder Gucci. Wo die Schönen und vor allem Reichen Anzüge, Kleider, Schuhe oder Koffer für vierstellige Beträge kaufen.
So wie ich schwitzend in meinem ausgeblichenen Shirt durch die Straße stapfte, fühlte ich mich wie ein Fremdkörper. Wahrscheinlich senkte ich das Pracht- und Prunklevel der Avenida Liberdade um mindestens 20 Prozent.
Ich schlängelte mich auf dem Bürgersteig durch Passant*innen, Tourist*innen, die vor den Fünf-Sterne-Hotels auf ihre Fahrer warteten, Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit waren (zumeist Verkaufspersonal aus den Luxusläden) oder von der Arbeit kamen (zumeist Reinigungspersonal aus den Luxusläden).
Den Restauradores-Obelisken ließ ich links liegen, nahm mir aber vor, später endlich zu googeln, was es mit ihm auf sich hat. Dann kam der Rossio-Bahnhof zu meiner Rechten, anschließend der Rossio-Platz mit dem noch monströser-phallischen Dom-Pedro-IV-Denkmal und der gepflasterten Wellen-Optik auf dem Boden zu meiner Linken.



Danach kam die Rua Áurea, wo mir an der kleinen Pasteleria neben dem gusseisernen Santa-Justa-Aufzug eine der Verkäuferinnen – wie jeden Morgen – ein Probierstückchen Pastel de Nata anbot, das ich – wie jeden Morgen – unter Aufbringung all meiner Willenskraft ablehnte.
Schließlich erreichte ich den Praça do Comércio, mit dem nicht phallischen, aber dennoch monströsen Reiterdenkmal von Jose I., umrundete ihn einmal – ein paar Extrameter sammeln – und bog schließlich ostwärts auf die Avenida Infante Dom Henrique ein.
Auf der rechten Seite floss der Tejo, auf der linken erhob sich Alfama. Ich passierte die Anlegestelle für die hochhaushohen Kreuzfahrtschiffe, die mehrmals in der Woche tausende Tourist*innen ausspucken, die dann wiederum von Bussen, Taxis und Tuktuks verschluckt und durch die Stadt kutschiert werden.

Weiter ging es vorbei am Fado-Museum, am Militär-Museum und am Milch-Museum, am Bahnhof Santa Apolónia, durch das Industriegebiet, mit seinen Kränen und Containern, bis zu der Zeltstadt unter der Brücke, wo, glaube ich, die Verkäufer aus den Souvenirshops schlafen. Dort drehte ich um, man will es schließlich nicht übertreiben und nicht überehrgeizig und überambitioniert wirken.


Fast sieben Kilometer hatte ich da hinter mir und war etwas erschöpft. Schließlich bin ich keine 20 mehr und mein Fitnesszustand ist gegenwärtig weit von der bestmöglichen Version meiner Selbst entfernt. (Allenfalls in der Ferne konnte der Fitnesszustand meine optimale Version sehen, aber er war zu langsam, um sie einzuholen.)

Folglich düste ich nicht im Sauseschritt, war zu meiner eigenen Überraschung aber plötzlich völlig losgelöst. Sehr plötzlich und sehr losgelöst.
Die Ursache: ein schlecht weggefräster Betonpoller, der fünf Zentimeter aus dem Boden ragte. Die fünf Zentimeter waren zu niedrig, um meine Aufmerksamkeit zu erregen, aber hoch genug, dass ich dagegen trat und ins Stolpern geriet.

Gerätst du normalerweise beim Laufen aus dem Tritt, aufgrund einer Wurzel oder einer Bodenunebenheit, fängst du dich mit ein paar Trippel-Schritten ab. Danach läufst du weiter, als wäre nichts passiert. Oder als wäre das Absicht gewesen, als hättest du das genauso geplant, als kleine Techniktraining-Einlage oder zum Lockern der Muskulatur.
Heute war aber nicht normaler-, sondern unnormalerweise. Meine Trippelschritte trippelten ins Leere, ich hob ab, flog drei, vier Meter durch die Luft – mein Schlüssel, meine Brille und das Handy ebenso –, landete schließlich auf Knien und Händen. Nachdem ich mich abgerollt hatte, auch noch auf dem Ellenbogen. (Wobei Abrollen eine Anmut und Eleganz impliziert, die möglichen Beobachter*innen vermutlich verborgen geblieben war.)
###
Nun liege ich in unwürdiger Position auf dem Bürgersteig und versuche, mich zu orientieren. Wo bin ich, wer bin ich und warum befinde ich mich auf dem Boden?
Während meiner unfreiwilligen Flugeinlage hatte ich noch gedacht: „Hoffentlich sieht mich niemand.“ Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt. Bei mir in dem Moment, als ich nach der Landung auf dem Asphalt nach oben schaue und feststelle, dass gerade eine der Pendler-Fähren angelegt hat.
Zahlreiche Menschen strömen aus dem Terminal. Ich weiß nicht, ob es Hunderte sind oder nur Dutzende. Ohne Brille ist das für mich schwer auszumachen, aber es waren definitiv mehr als niemand.
Ich bin versucht, zu rufen: „Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen.“ Das ist aber gar nicht nötig. Die Menschen nehmen erstaunlich wenig Notiz von dem Trottel, der da über den Boden gekullert ist. Fast wie in Berlin.
Als ich meinen Blick weiter nach oben richte, erkenne ich schemenhaft zwei Inder. Sie stehen vor mir und schauen mich mit großen Augen an. Die beiden sprechen miteinander, einer deutet auf den Poller-Reststummel. Hätte er das zehn Sekunden früher getan, wäre das hilfreicher gewesen.
Dafür helfen sie mir beim Zusammensuchen meiner nicht Sieben- aber Dreisachen. Zumindest ein bisschen, indem sie mich mit ausgestreckten Armen zu Brille, Handy und Schlüssel dirigieren. Nachdem ich alles beieinander habe, murmle ich: „Obrigado, thank you, obrigado“.
Kurz begutachte ich meine blutenden Knie und Ellenbogen. Ich sehe aus wie ein Vierjähriger, der gerade Fahrradfahren lernt. Schließlich setze ich meinen Lauf humpelnd fort, um mich schnellstmöglich vom Ort der Schande zu entfernen.
Ich denke, ab heute sollte der Name von Lissabon angepasst werden: „Die Stadt der sieben Hügel, der tausend Anstiege, der tausend Abstiege sowie zahlreicher Unannehmlichkeiten, wie zum Beispiel glatte Bürgersteige, holpriges Kopfsteinpflaster, nervige Fußgängerampeln und schlecht weggefräste Betonpoller.“

Sie möchten informiert werden, damit Sie nie wieder, aber auch wirklich nie wieder einen Familienbetrieb-Beitrag verpassen?

Sie möchten informiert werden, damit Sie nie wieder, aber auch wirklich nie wieder einen Familienbetrieb-Beitrag verpassen?


Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)
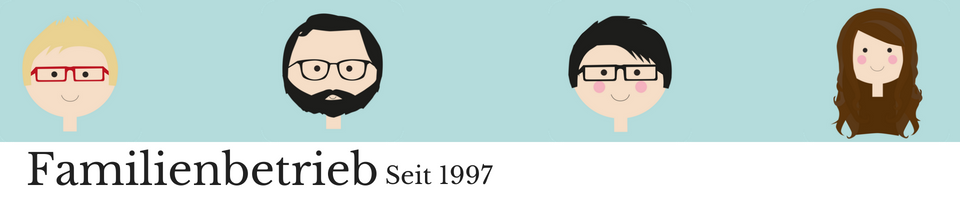










Aua. Das tut schon weh. Und ich lese das nur.
Zum Glück ist das ja schon ein wenig her.