Setting und Methode
Das hier vorgestellte ethnologisch-kulturanthropologische Forschungsprojekt fand im Rahmen eines einwöchigen Urlaubsaufenthalts in Albufeira statt (6. bis 14. Juni 2025). Als Erhebungsmethode diente die semi-teilnehmende Beobachtung, durchgeführt während mehrerer ausgiebiger Spaziergänge durch die Altstadt. Das daraus resultierte Untersuchungsmaterial umfasst Beschreibungen sichtbarer Praktiken und spontaner Eindrücke sowie auditive Kartierungen.
Die explorativ angelegte Untersuchung fokussierte darauf, wie soziale Dynamiken, kulturelle Bräuche und Rituale der Vergemeinschaftung einen Ort des Außeralltäglichen generiert, an dem sich die Spaß- und Erlebnisgesellschaft materialisiert. Zusammengefasst lautete die forschungsleitende Fragestellung: „Was zur Hölle geht hier ab?“
Zur Einordnung der Studienergebnisse sei darauf hingewiesen, dass die Forschenden weder der Landessprache mächtig sind noch über einen ethnologischen oder kulturanthropologischen Hintergrund verfügen. Daher lassen sich ihre Schlussfolgerungen möglicherweise nur bedingt verallgemeinern, wobei „bedingt“ in diesem Zusammenhang als „auf gar keinen Fall“ zu verstehen ist.

Das Feld: Vom Fischerdorf zum Fun-Hub
Das ehemalige Fischerdorf Albufeira liegt an der Algarveküste im Süden Portugals und gilt heute als massen- und partytouristischer Knotenpunkt. In den Sommermonaten steigt die Einwohner*innenzahl von rund 44.000 auf mehr als 300.000.
Online-Artikel von kommerziellen Fremdenverkehrsanbietern sowie private Reiseberichte heben als traumhaft bezeichnete Strände, charakteristische Küstenlandschaften, weitläufige Buchten und goldene Klippen sowie die zahlreichen Möglichkeiten zur Abendgestaltung hervor. In den schriftlichen Materialien tauchen auffällig häufig Adjektive wie „geschäftig“, „pulsierend“, „lebhaft“ und „dynamisch“ auf.
Trotz einer rund 2.000-jährigen Geschichte ist die Altstadt Albufeiras, die als touristisches Zentrum gilt, nur mäßig alt. 1755 überflutete ein Tsunami den unteren Teil der Stadt, im Bürgerkrieg von 1823 wurde Albufeira von einem Feuer fast vollkommen zerstört. Ereignisse, auf die die Bewohner*innen Albufeiras angesichts der disruptiven Auswüchse des modernen Party-Massentourismus mit nostalgischer Wehmut zurückblicken.
Freizeitökonomische Infrastruktur
In der Altstadt Albufeiras materialisiert sich die dichte touristische Durchökonomisierung des Ortes. Andenkenläden, Mini-Supermärkte, auf Strandmode und -bedarf spezialisierte Geschäfte, Eisdielen und andere gastronomische Einrichtungen auf engstem Raum schaffen Konsumgelegenheiten zur Befriedigung urlauberischer Bedürfnisse.

Die Preise, ästhetische Gestaltung sowie Verarbeitungsqualität der angebotenen Souvenirs lassen vermuten, dass es sich nicht um Produkte aus portugiesischen Handwerks-Manufakturen, sondern größtenteils um fernöstliche Importware handelt.
Nationale Sozialstruktur: Little Britain
Plätze und Straßen sowie Restaurants und Bars sind mehrheitlich von englischen Staatsangehörigen frequentiert. Eine als probabilistisch zu verstehende Zuschreibung, da keine Passkontrollen zur Feststellung der Nationalität vorgenommen wurden. In Nordengland verortete Dialekte, Habitus, rötliche Hautschattierungen sowie eine ausgeprägte Vorliebe für Premier-League-Fußballtrikots können jedoch als starke Indizien für diese These gelten.
Den Wunsch der englisch gelesenen Urlaubenden nach heimischer Vertrautheit erfüllt eine hohe Dichte an Pubs sowie zahlreiche English-Breakfast-Angebote, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Dadurch entsteht ein Fundament der soziokulturellen Selbstvergewisserung, auf dem im Urlaub die Loslösung vom eigenen Ich und der Bruch mit dem Alltag überhaupt erst möglich werden.

Gastronomie: Kalorien statt Haute Cuisine
Die zahlreich vorhandenen Restaurants sind international-kosmopolitisch ausgerichtet und zielen darauf ab, das Bedürfnis nach schnell sättigendem Essen zu befriedigen, das als Folge übermäßigen Alkoholkonsums auftritt. Das Angebot: Italienisch (Pizza), Amerikanisch (Burger), Mexikanisch (Tacos), Japanisch (Sushi), Indisch (Curry) und vieles mehr. Die portugiesische Küche ist dagegen erstaunlich unterrepräsentiert.
Weit verbreitet ist die Praxis des aufdringlichen Front-of-House-Recruitments. Wer nicht schnell genug wegschaut, wird von Kellner*innen in Gespräche verwickelt. Als Instrument der Persuasion dienen aufgeklappte Speisekarten mit schlecht belichteten, dilettantisch freigestellten Gerichten. Ob die Bildästhetik ein Indikator für Essensqualität darstellt, bleibt empirisch ungeklärt.


Kleiderordnung: Oben-ohne-Esser und T-Shirt-Freundschaften
In vielen Restaurants scheint es gesellschaftlich akzeptiert, mit nacktem Oberkörper zu speisen. Eine Praxis, die auf eine Urlaubs-Ausnahmeethik hindeutet, die sowohl hygienische Normvorstellungen als auch das Konzept der sozialen Scham situativ außer Kraft setzt.
Unter den Oben-Ohne-Gästen finden sich in der Regel keine Bademoden-Models, die ihre Freizeit in Fitnessstudios und mit körperlicher Ertüchtigung verbringen. Auf das Tragen von Oberbekleidung verzichten zumeist Männer, die von übermäßigem Konsum alkoholischer Getränke und fettiger Speisen gezeichnet sind, in einigen Fällen zusätzlich von dermatologisch bedenklicher Sonnenexposition. Eine Beobachtung, die nicht als Bewertung im Sinne des Body-Shamings zu verstehen ist, sondern Körperpolitiken im touristischen Kontext objektiv beschreibt.
Ein anderes Phänomen der textilen Normierung lässt sich bei den in der Altstadt stark vertretenen Kleingruppen beobachten. Zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls tragen diese häufig gleiche, bedruckte T-Shirts, die auf den Ferienort sowie die Urlaubsintention verweisen. („Sex, Drugs and Rock’n’roll – Portugal 2025“, „Steve’s last week in freedom”, “Bride squad: Olivia’s hen party – Albufeira 2025”)
Diese T-Shirts sorgen für Gesprächsstoff, ermöglichen den Eintritt in eine feiernde, anonymisierte Masse sowie die Verbrüderung mit Fremden und erleichtern – unterstützt durch Intoxikation – die Loslösung vom eigenen Ich.
Alkohol: Niedrigschwellige Angebotsökonomie
Der Konsum von Alkohol spielt eine wichtige Rolle im Urlaubsalltag von Albufeira, er wird quasi zu jeder Tages- und Nachtzeit praktiziert. Von jungen Menschen ebenso wie von Rentner*innen, Schichtzugehörigkeit stellt dabei kein differenzierendes Merkmal dar.
Die örtliche Gastronomie unterstützt die Urlaubenden bei der Befriedigung ihres Bedürfnisses nach Alkohol. Vor vielen Lokalen kommunizieren große Tafeln Happy-Hour-Angebote. Ein Liter Sangria für zehn Euro, ein Aperol Spritz für fünf Euro, ein Pint Bier für 2,50 Euro.
Diese Preisinszenierung erleichtert niedrigschwellige Kaufentscheidungen, insbesondere nach bereits erfolgtem Alkoholkonsum. Die daraus resultierende Stimmungslage kann als feucht-fröhlich kategorisiert werden. (Bei der ein oder anderen motorisch unsicheren Person mitunter mehr feucht als fröhlich.) Die im Alltag etablierte Ordnung wird relativiert, ein Ausnahmezustand der Ekstase und des Archaischen entsteht.
Der Griff zu alkoholischen Getränken dient neben der Auflösung der Triebsublimierung auch der Konstruktion von Gender-Identitäten. Weiblich gelesene Personen greifen eher zu Longdrinks, fruchtigen Cocktails und Sangria, männlich gelesene dagegen in der Regel zu Bier, wodkabasierten Mischgetränken sowie hochprozentigen Shots.
In einer Situation wurde ein Mann bei der Bestellung eines Aperol Spritz beobachtet. Dies löste in seiner Peer-Group kurzfristig einen Zustand der fragilen Maskulinität aus. Diesen überwanden die „mates“, indem sie diese Getränkewahl als Indiz für gleichgeschlechtliche sexuelle Vorlieben werteten.

Klanglandschaften: Soundtrack der Vergemeinschaftung
Das musikalische Repertoire der Pubs und Bars ist stark retro-orientiert. Dominierend sind englischsprachige Hits der 70er bis 90er Jahre.
Immer wieder und wieder werden die gleichen partytauglichen Lieder gespielt, die Nähe erzeugen, Hemmungen abbauen und eine zwanglose Zusammenkunft gleichgesinnter Menschen ermöglicht. („Wo gesungen wird, da lass dich nieder …“)
Top-Ten der meistgespielten Songs
- „Wonderwall“
- „Sweet Caroline“
- „Don’t Look Back in Anger“
- „Zombie“
- „Angel“
- „Be My Baby“
- „Hey Jude“
- Nochmal: „Wonderwall“
- Erneut: „Sweet Caroline“
- Wieder: „Don’t Look Back in Anger“
Viele Pubs und Bars locken potenzielle Gäste mit Live-Performances, wobei die Auftritte oftmals von zweifelhafter Qualität sind. Die meisten Musiker*innen scheinen autodidaktisch ausgebildet zu sein, vermutlich durch YouTube-Tutorials ohne Ton.
Für das Publikum ist Virtuosität der Darbietung aber nicht handlungsleitend, sondern die Wiedererkennbarkeit und Mitsingbarkeit der Songs. Ausdrucksformen reichen von rhythmischem Klatschen über Chorgesang bis zu Auf-den-Tischen-Tanzen. Soziale Grenzen lösen sich auf, Statusunterschiede verschwinden, ein Gefühl der Vergemeinschaftung herrscht vor.
Ob diese kollektiven Verdichtungen als ritualisierte Partizipation oder episodische Massenhysterie zu fassen sind, wäre in weiterführenden Studien zu klären.

Flirtökologie: Zwischen Erwartung und Enttäuschung
Viele der Tourist*innen, insbesondere in den jüngeren Altersgruppen, hegen im Urlaub den Wunsch nach sexuellen Begegnungen und One-Night-Stands. Ein Anliegen, das durch die ständige Verfügbarkeit alkoholischer Getränke sowie die Auflösung der im Alltag etablierten Ordnung begünstigt wird.
Allerdings sind männliche Peer-Groups in der Altersspanne von 20 bis 30 überproportional vertreten, gleichaltrige Frauen dagegen sichtbar unterrepräsentiert. Die daraus entstehenden ungleichen Geschlechterverhältnisse lassen die alkoholgerahmten Erwartungen der „lads“ nach erotischen Begegnungen (flirt- und körperkontaktbezogen) als statistisch unsicher erscheinen.

Vorläufige Schlussfolgerung
Albufeiras Altstadt präsentiert sich im untersuchten Zeitfenster als hochgradig touristifizierte Nachtökonomie mit einer kompakten Anordnung von Unterhaltungsmöglichkeiten, die durch internationale Kulinarik, aggressive Gästeakquise, retro-musikalische Vertrautheit und männlich konnotierte Gruppenperformanzen strukturiert ist.
Die Abwesenheit lokaler Kulinarik, die Überpräsenz preisbasierter Anreize und die entgrenzten Kleidungs-/Körperpraktiken manifestieren einen Ort des Erlebnistourismus, in dem sich Konsum, Lautstärke und Vergemeinschaftung kurzfristig zu einem Zustand des Außeralltäglichen verdichten. Kurz zusammengefasst: Albufeira ist ein Party-Hotspot, wo jeden Abend die Kuh fliegt, der Bär steppt, die Post abgeht und der Engländer trinkt.
Alle “Post aus Portugal”-Beiträge finden Sie hier.
Sie möchten informiert werden, damit Sie nie wieder, aber auch wirklich nie wieder einen Familienbetrieb-Beitrag verpassen?


Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)
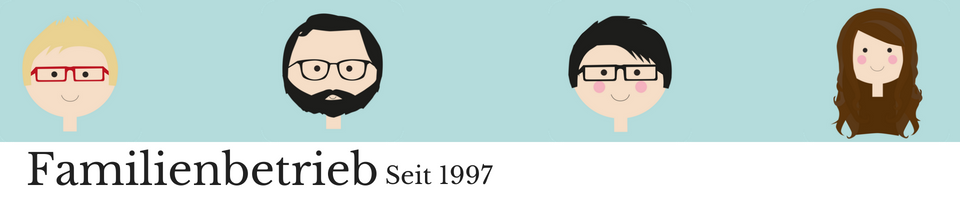








Das ist mit Abstand der coolste Reisebericht, den ich je gelesen habe. Vielen lieben Dank dafür.
Das freut mich.
breit grinsend habe ich diese beste aller Beschreibungen des „Ballermann“ der Algarve inhaliert,
vielen lieben Dank dafür
Sehr gerne.
Ich bin begeistert, danke für den farbenfrohen Lesegenuss! 😂🤣😁
Das freut mich.