Der 11. November ist nicht nur Start der Karnevalssaison, sondern auch der Tag, an dem Sankt Martin gefeiert wird. Ein römisch-ungarischer Soldat, dessen Popularität darauf beruht, einem mittel- und obdachlosen Mann einen halben Mantel geschenkt zu haben.
Ein Akt von solcher Güte, dass mehr als 1.600 Jahre später bedauernswerte Eltern im November immer noch mit ihren Kindern, die mit Laternen bewaffnet sind, bei Dunkelheit, Kälte und Nässe Lieder singend durch die Straßen ziehen müssen. Danke, Martin.
In gewohnt investigativ-wissenschaftlicher Manier geht die neueste Ausgabe von „Wissen macht: Hä?“ den wichtigsten Fragen rund um Sankt Martin nach: Wer war dieser Martin eigentlich, was ist genau zwischen ihm und dem Bettler passiert, wieso begegnen Gänse dem Martinstag eher skeptisch, warum latschen wir mit Laternen durch die Gassen, und was singen wir dabei?
Alles, damit Sie, werte Leser*innen, beim nächsten Small-Talk tagesaktuell glänzen können. Bitte, gerne.
„Wissen macht: Hä?“, die Infotainment-Rubrik mit mittelmäßig wenig Info und mittelmäßig viel tainment zu Jahres- und Feiertagen, geschichtlichen Ereignissen sowie aktuellem Zeitgeschehen. Wer regelmäßig „Wissen macht: Hä?“ liest wird wahrscheinlich nicht klüger, aber auch nicht dümmer. Vielleicht.

Who the Fuck is Martin?
Der Heilige Martin erblickte 316 in der römischen Provinz Pannonien prima, dem heutigen Szombathely in Ungarn, das Licht der Welt. Möglicherweise aber auch erst 317. Die Geschichtsschreibung lässt es da ein wenig an Präzision missen. Ursächlich für die mangelnde Eindeutigkeit soll ein gefälschter Schülerausweis sein, mit dem sich der junge Martin in die pannonischen Discotheken schlich.
Sein Dad war römischer Militärtribun und weil damals das Motto „wie der Vater so der Sohn“ galt, musste Martin ebenfalls eine Militärlaufbahn einschlagen, obwohl er darauf überhaupt kein Bock hatte. (Was er mit den meisten Jugendlichen von heute gemein hat.)
331 wurde er Soldat, zunächst diente er als Leibwache von Kaiser Konstantinius II. Mit gerade mal 15. (Oder sogar 14.) Was die Frage aufwirft, wie ernst das römische Militär die Verteidigung des Kaiserlichen Lebens nahm, wenn es dafür die jüngsten und unerfahrensten Soldaten einsetzte.
Martin und der Bettler: Geteilter Mantel ist halber Mantel
334 verschlug es Martin zur Reiterei der Kaiserlichen Garde in Amiens. Vielleicht auch erst 338. Mittlerweile wissen Sie ja, dass Historiker es mit Jahreszahlen nicht so genau nehmen und einfach würfeln. Auf jeden Fall kam es damals zu der berühmten Bettler-Mantel-Episode.
Um auf sein 10.000-Schritte-Tagesziel zu kommen, flanierte Martin durch die Stadt und traf dabei auf einen unbekleideten Mann. Der frönte nicht aus freien Stücken der Freikörperkultur, sondern war zu arm, um sich Klamotten zu leisten.
Als Mann der Tat teilte Martin kurzerhand seinen Mantel mit dem Schwert – was genau genommen eine Beschädigung von Militäreigentum darstellte – und gab dem Obdachlosen die halbe Joppe. Ein mittelmäßig smarter Move, denn ein halber Umhang hilft keinem so richtig weiter. Außer du bist ein Eichhörnchen.
Anstatt den Bettler zu fragen, ob er sonst noch etwas braucht, zum Beispiel etwas zu essen oder Geld, zog Martin weiter. Wahrscheinlich war ihm kalt.
Nachts träumte Martin dann von Jesus. Der trug den halben Mantel des Bettlers und bedankte sich dafür. Was zur Hölle, Jesus? Einem Obdachlosen den Mantel abziehen? Geht’s noch?
Martin fand das Gebaren des Gottessohns aber nicht befremdlich. 351 ließ er sich taufen, fünf Jahre später zeigte er dem Militärdienst den Mittelfinger.

Vom Jesus-Fanboy zum Bischof
In den folgenden Jahren verschrieb sich der ex-Soldat der Christianisierung der Landbevölkerung und ging dabei all-in. Seine Lieblingsbeschäftigung war die Zerstörung heidnischer Stätten und der Bau von Kirchen und Klöstern. Für Ideen der ökumenischen Toleranz interessierte er sich anscheinend weniger.
In den folgenden Jahren machte sich Martin einen Namen als Nothelfer und Wundertäter. Beispielsweise soll er Tote erweckt haben, indem er sich über Leichen beugte und betete. Das fanden die Verstorbenen so unangenehm, dass sie ins Leben zurückkehrten, Hauptsache der übergriffige Martin lässt von ihnen ab.
371 wurde Martin zum Bischof von Tours geweiht. Oder 372. (Who the fuck cares?) Eigentlich wollte er das gar nicht und kokettierte damit, er sei dafür nicht würdig. War den Menschen aber egal und er musste das Amt trotzdem ausüben.
Am 8. November 397 verstarb Martin. Sein letzter Satz auf dem Sterbebett lautete angeblich: „Den Tod fürchte ich nicht, weiter zu leben, lehne ich aber nicht ab.” Der Sensenmann ließ sich jedoch auf keine Diskussionen ein und beförderte ihn ins Jenseits.
Gefeiert wird der Heilige Martin am 11. November, dem Tag seiner Beisetzung. Einen Tag vorher findet der Martinitag statt, anlässlich des Geburtstags von Martin Luther. Womit die Aufgabe „Wie stifte ich maximal größte Verwirrung“ erfolgreich erledigt wurde.
Holy shit!
Um 500 rum ernannte Chlodwig I. Martin zum Nationalheiligen und Schutzherrn der fränkischen Könige. Nicht ganz uneigennützig, schließlich war er selbst amtierender Franken-Babo.
Weil der Heilige Martin als royaler Aufpasser nicht ausgelastet ist, fungiert er zusätzlich als Schutzpatron für Reisende, Flüchtlinge, Gefangene, Reiter, Arme, Bettler, Weber, Haustiere und etwas verwirrend sowohl der Winzer als auch der Abstinenzler.
Sankt Martin war der erste Heilige, der nicht als Märtyrer ums Leben kam, sondern schlicht an Altersschwäche starb. Was dramaturgisch etwas öde ist, für Martin aber ganz angenehm war. Schließlich ist es nicht besonders angenehm, dich in deinen letzten Stunden mit brennendem Eisen, Rädern und Vierteilen traktieren zu lassen.
Die Martins-Gans: Eat the snitch!
Keine besonders großen Fans des Heiligen Martins sind Gänse. Die werden zu Ehren des Kirchen-und-Kloster-Baumeisters verspeist. Zusammen mit Rotkohl und Klößen, die dem früheren Bischof von Tours ebenfalls reserviert gegenüberstehen.
Für die Tradition des Martingans-Essens gibt es zwei Erklärungen: Als Martin sich vor dem Bischofsamt drücken wollte, versteckte er sich in einem Gänsestall. Die Herren und Frauen Ganteriche hatten für diesen Akt des Stallfriedensbruchs wenig übrig und verrieten ihn durch lautes Geschnatter. Zur Strafe landeten sie im Bräter.
Laut einer anderen Sage watschelte während eines Gottesdienstes eine Gans in die Kirche und störte die Predigt des frisch geweihten Bischofs mit ihrem nervigen Gequacke. Wofür sie geschlachtet und gegessen wurde.
Egal welche der Geschichten stimmt, deuten sie beide auf eine cholerische und rachsüchtige Seite hin, die so gar nicht zum sorgsam gepflegten Image des Mantel zerschnippelnden Wohltäters passen will.
Was Rotkohl und Klöße dem Bischof von Tours angetan haben, ist nicht überliefert.

Der Stutenkerl: Goodbye Stuhlgang
Ebenfalls fester kulinarischer Bestandteil des Martinsfests ist der Stutenkerl. Klingt wie ein kerniger Dorfbursche, von dem sich die Madeln mal gerne durchnudeln lassen würden, ist aber ein Gebäck in Männchenform. Das aus so viel Weißmehl und Zucker besteht, dass du schon vom bloßen Anblick tagelang Verstopfungen hast.
Warum der Weckmann mit einer Tonpfeife ausgestattet ist, weiß niemand so genau. Vielleicht hat der Heilige Martin ab und an ein Pfeifchen Weihrauch durchgezogen, um sich von den Bischofstrapazen zu entspannen.

Das Laternenfest: Fire walk with me
Irgendwann dachte sich jemand, dass ein Haufen Vierjähriger, Papierlaternen und offene Flammen eine gute Kombination sei. Warum bleibt schleierhaft.
Weil zu dieser Jahreszeit ausnahmslos alle Kinder hochansteckende Viren ausbrüten, verwandeln sie so einen Laternenumzug schnell in ein Super-Spreader-Event. Das kann ganze Volkswirtschaften in die Knie zwingen.
Bei den High-End-Martins-Märschen reitet irgendein Rich Dad vorneweg und mimt den Heiligen. Das Pferd fragt sich derweil, wo im Leben es falsch abgebogen ist, dass es im November im Dunklen über rutschige Straßen klappern muss, umgeben von Laternen und Fackeln und Kindern mit leicht entzündlichen Polyester-Anoraks. What could possibly go wrong?
Ein ordentlicher Laternenumzug endet mit einem Martinsfeuer. Je größer, desto besser. Das Feuer steht für das Licht in der Dunkelheit, so wie Martin mit seinen guten Taten das Erbarmen Gottes in die Dunkelheit der Gottesferne brachte. Außerdem ist so ein Feuer eine gute Möglichkeit alte Möbel und Autoreifen loszuwerden.

Das Laternenbasteln: Der zehnte Kreis der Hölle
Noch schlimmer als die unheilvolle Fackel-Lampion-Prozession ist das vorherige gemeinsame Laternenbasteln. Schon bei der Ankündigung dieses Termins verlieren Eltern jeglichen Lebenswillen.
An dem verhängnisvollen Bastelmittag verwandelt sich die Kita in einen türlosen Escape Room, in dem es nach Verzweiflung und Klebstoff riecht. Mütter und ein paar wenige Väter hocken mit starrem Blick auf zu kleinen Stühlen und hantieren mit einer Schere, die nur von linkshändigen Elfen bedient werden kann.
Dabei versuchen sie, etwas zu basteln, das nicht wie ein modernes Kunstwerk aussieht, auf das sich ein Elefant gesetzt hat. Ohne Erfolg. Aber wenigstens kann man am Klebstoff schnüffeln.

Das Liedgut: Wo gesungen wird, lass dich auf keinen Fall nieder
Zur unguten Tradition des Martinfests gehört die gemeinsame Singerei. Von Liedern, die entweder die Laternen beschwören oder dem Heiligen Martin himself huldigen.
Einer der größten Martins-Bänger ist Ich geh mit meiner Laterne. Ein vertontes Nichts, in dem das lyrische Ich von einem Spaziergang mit seiner Laterne berichtet und diese geht auch mit ihm spazieren. So weit, so ungut. Und vor allem verwirrend.
Dann lässt sich der Erzähler darüber aus, dass oben die Sterne leuchten und unten er und die Laterne. Dramaturgisch ungefähr so spannend wie Magerquark.
Im Refrain wird mehrfach „Rabimmel, rabammel, rabum“ gegrölt, womit sich das Lied auf das textliche Niveau eines Rammstein-Songs begibt.
Das Lied stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert. Eine Zeit, in der Kinder noch im Bergbau Kohle schaufelten. Was ungefähr genauso viel Spaß macht, wie sich dieses Lied anzuhören.
Nicht ganz so handlungsarm kommt Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind daher und erzählt die allseits bekannte Geschichte vom Bettler und der Mantelteilung. („Tue Gutes und lass andere davon singen.“)
Um niemandem etwas zuzumuten, kommt das Lied in einer massenkompatiblen Dur-Tonart daher. Trotz des heroischen Titels ist die Melodie so aufregend wie lauwarmer Glühwein, den es aber nicht gibt, wegen Kinderveranstaltung und so.
Wer auch immer für Laterne, Laterne verantwortlich ist, hätte nicht deutlicher machen können, dass er auf den Scheiß so überhaupt keine Lust hat. Ganze fünf Töne, hat das Lied zu bieten. Was vielleicht blockflötentauglich ist, aber trotzdem an Arbeitsverweigerung grenzt. (Da bekommt Fritze Merz gleich Schnappatmung.)
Textlich hat sich der Autor auch einen ganz schmalen Fuß gemacht.
„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne,
brenne auf mein Licht,
brenne auf mein Licht,
nur meine liebe Laterne nicht.“
Hört sich an wie eine Domina, die einem Teelicht Befehle erteilt. „Brenne. Auf. Mein. Licht.“
Immerhin taugt die nervtötende Wiederholerei der immer gleichen Zeilen als Mantra, um die Frontallappen auf Standby zu stellen. Dann lässt sich der Martinsumzug auch ohne Glühwein-mit-Schuss-Abusus ertragen.
###
Allen Eltern, die zum Martinsumzug müssen, starke Nerven, den Kindern viel Spaß ohne brennende Laterne und allen ein kräftiges Rabimmel, Rabammel, Rabum.

Alle Folgen von “Wissen macht: Hä?” finden Sie hier.
Sie möchten informiert werden, damit Sie nie wieder, aber auch wirklich nie wieder einen Familienbetrieb-Beitrag verpassen?


Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)
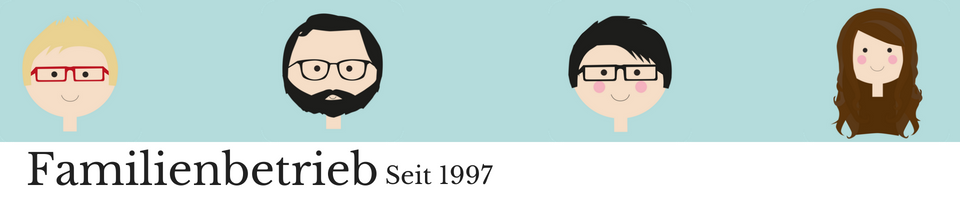
Zum Parlament der Vögel: Bei uns im randsorbischen Gebiet wird Ende Januar die Vogelhochzeit gefeiert. Hatte ich bisher als erstes Ritual in Richtung „Winter, verzeih dich, jetzt soll es Frühling werden“ verstanden, geht aber evtl. auch in diese Richtung.
Japan finde ich interessant mit der Retourkutsche im Monat darauf. Hierzulande schenken typischerweise Männer am 14.02. Blumen und Schoki (was Frauen sich angeblich wünschen), dafür ist am 14.03. der nicht ganz so bekannte SchniBlo-Tag. Echte Männer macht man als gutes Weibchen mit Schnitzel und Bl*wJob glücklich. Mit Blumen könnte der eh nichts anfangen.
Danke. Wieder was gelernt. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.
😃
Die Rezeption dieses Textes war ebenso vergnüglich wie die der Sozialstudie davor.
Ich erweitere noch:
Nachdem irgendwann doch jemandem auffiel, dass Vierjährige und echte Kerzen eventuell eine etwas zu aufflammende Beziehung führen könnten, wurden die elektrischen Laternenstäbe erfunden.
Es handelt sich dabei um ausnehmend potthässliche Plastestäbe, die trotz LED-Lampen mindestens zwei Batterien brauchen. Vorne ist ein Haken und an einem Kabel baumelt ein Lämpchen. (Etwa so wie bei diesem Tiefseefisch.)
Ahnungslose Eltern, die erst eine Woche vor dem Umzug einen solchen Stab erwerben wollen, hetzen dann in mehrere Drogeriemärkte.
Hat man das Teil erstmal erworben, treibt einen der Nachwuchs mit der Flackerfunktion in den Wahnsinn. Selbstverständlich versagt das Licht pünktlich 3 min nach Beginn des Umzugs.
Das ist eine sehr zutreffende Beobachtung.