»WILLE ABER NICHT!« Es ist Sonntag, 18 Uhr, und die Freundin hat der Tochter gerade erklärt, dass es Zeit für die Badewanne ist. Diese hält Baden aber für einen inakzeptablen Hygieneterror, was sie lautstark kundtut. Mit mehreren Kubikmetern Badeschaum, einer Armada an Badetieren sowie einigen unverhohlenen Drohungen bezüglich des Fernsehkonsums in nächster Zeit gelingt es der Freundin doch, die Tochter zu überreden, in die Wanne zu steigen. Als sie eine Viertelstunde später ankündigt, nun sei es Zeit rauszukommen, brüllt die Tochter wieder: »WILLE ABER NICHT!«
Dieses »WILLE ABER NICHT!« ist der häufigste Satz, den die Tochter zurzeit sagt. Sie befindet sich nämlich in der Trotzphase. Und zwar ungefähr, seit der Sohn geboren wurde. Wahrscheinlich ist die Tochter ein wenig eifersüchtig auf ihren Bruder. Das lässt sie aber nie an ihm aus. Dafür an uns. Mehrmals täglich gibt sie uns zu verstehen, dass sie uns für die herzlosesten, ungerechtesten und hinterhältigsten Menschen der Welt hält, die sich bestenfalls als Diktatoren zentralasiatischer Scheindemokratien eignen, nicht aber als treusorgende Eltern, die sich liebevoll um ihre Erstgeborene kümmern und dieser jeden Wunsch von den Lippen ablesen.
Da die Freundin auch nach der Geburt des Sohnes als Erste von uns beiden die Elternzeit genommen hat, muss sie meistens die cholerischen Ausbrüche der Tochter ertragen. Insbesondere auf dem Heimweg von der Tagesmutter spielen sich Tag für Tag Tragödien ab, wie man sie allenfalls im Theater des antiken Griechenlands erleben konnte.
»Das ist die absolute Hölle«, klagt die Freundin abends, als wir im Bett liegen und sie den Sohn stillt. In meinem steten hilfsbereiten Streben, meinen Mitmenschen konstruktive Lösungsvorschläge für ihre Alltagsprobleme zu unterbreiten, empfehle ich der Freundin, sie müsse auf dem Heimweg einfach ein wenig gelassener sein, dann sei auch die Tochter entspannter.
Mein Ratschlag führt bei der Freundin allerdings weder zu Gelassenheit noch zu Entspannung, sondern sie knurrt ein paar unterdrückte Unflätigkeiten. Wider besseres Wissen weise ich sie darauf hin, dass es genau diese aufbrausende Unbeherrschtheit sei, die sich negativ auf die Stimmung der Tochter auswirke.
Es kommt in der Folge zu einem kurzen, leicht emotionalen Austausch unserer Standpunkte, bei dem wir zugegebenermaßen die Regeln der aristotelischen Diskursführung nicht immer penibel befolgen. Wäre der Sohn schon älter, würde er sich wahrscheinlich eine Schüssel Popcorn holen, um dieses Schauspiel zu genießen. Schließlich fordert die Freundin mich auf, ich könne die Tochter morgen ja abholen, wenn ich so gut Bescheid wüsste.
Nachdem ich mich in unserem Meinungsaustausch wie ein pädagogisches Genie aufgespielt habe, das dem dänischen Erziehungsguru Jesper Juul Nachhilfe gibt, kann ich mich dieser Aufforderung schwerlich entziehen. Möglichst cool antworte ich, dies sei überhaupt kein Problem, wobei das leichte Zittern in meiner Stimme meine zur Schau getragene Lässigkeit ein wenig schmälert.
Am nächsten Tag verlasse ich nachmittags frühzeitig das Büro und fahre mit der U-Bahn zur Tagesmutter. Auf dem Weg denke ich über meine bevorstehende Abholmission nach. Das A und O im Umgang mit Kindern besteht bekanntermaßen ja darin, immer konsequent zu bleiben. Wenn man eine Ansage gemacht hat, muss man dazu stehen und darf auf keinen Fall nachgeben. Für Eltern und die GSG 9 gibt es nur ein Credo: Mit Terroristen und kleinen Kindern wird nicht verhandelt! Ein Grundsatz, für den mich Bernhard Bueb, der Gottvater der schwarzen Pädagogik, sicherlich gerne in den pädagogischen Beirat des mit Zucht und Ordnung geführten Eliteinternats Salem berufen würde.
Mein vibrierendes Handy reißt mich aus meinen Gedanken. Die Freundin hat eine Nachricht geschickt und wünscht mir viel Spaß beim Abholen. Ein kleines Smiley grinst mich höhnisch an. Ich lasse mich nicht provozieren und antworte mit einem Herz-Emoji.
Als ich bei Frau Preussig, der Tagesmutter, klingle, ist die Tochter noch ins Spiel vertieft. Ihre Begeisterung über mein Kommen ist so groß, dass sie nicht imstande ist, diese zu zeigen. Stattdessen überkompensiert sie und ignoriert mich. Meinen Grundsatz befolgend, bleibe ich gelassen. Schließlich ist das Kind erst seit acht Stunden bei der Tagesmutter, da ist es nur verständlich, dass sie jetzt noch spielen muss. Nach knapp zwanzig Minuten ist sie zur Kontaktaufnahme bereit, und ich kann sie überzeugen, dass wir aufbrechen.
An der Garderobe im Hausflur weigert sie sich, ihre Jacke anzuziehen. Da es draußen regnerisch und kühl ist, erkläre ich ihr geduldig, dass sie aufgrund der widrigen Wetterbedingungen nicht ohne Jacke rausgehen könne. Die Tochter findet aber, die Jacke sei doof und kratze. Ich erwidere – immer noch vollkommen ruhig –, sie habe sich die Jacke doch selbst ausgesucht und außerdem sei sie innen ganz weich und kratze gar nicht. Die Tochter ist anderer Meinung. Sie hält die Luft an und bekommt einen roten Kopf.
Mit Engelszungen, aber ohne nennenswerten Erfolg, rede ich auf sie ein. Schließlich zwänge ich sie mit sanfter Gewalt bei gleichzeitig größtmöglicher väterlicher Zuneigung in ihre Jacke. Die Auszeichnung als »Vater des Jahres« rückt in weite Ferne.
Draußen auf dem Gehweg trottet die Tochter lustlos wie das Sanostol-Kind hinter mir her. Erst als wir die Bäckerei vor der U-Bahn-Station erreichen, hellt sich ihr Gesicht auf. Sie gibt mir zu verstehen, es wäre ihr ein großes Vergnügen, ein Croissant zu verzehren. Allerdings erachtet sie dabei die Verwendung bürgerlicher Höflichkeitsfloskeln als unnötig. Auch ihr Satzbau ist – wohlwollend betrachtet – eher als effizient zu bezeichnen. Eigentlich ist es mehr eine Art Befehl, und zwar in einem Tonfall, der eines Ausbilders der US-Militärakademie West Point würdig wäre.
»WILLE EIN CROISSANT!«, brüllt die Tochter durch die Fußgängerzone. Ich schaue sie leicht tadelnd – aber immer noch mit valiumhafter Entspanntheit – an und frage sie: »Wie sagt die Mama von Leo Lausemaus immer? ›Wer ganz viel will, bekommt am Ende gar nichts.‹«
Die Tochter hält die Lausemaus-Mama mit ihren antiquierten Vorstellungen über akzeptable Umgangsformen sicher für eine reaktionäre Spießerin. Sie stampft mit dem Fuß auf und schreit: »WILLE ABER!!!« Ich entgegne ihr: »So schon gar nicht, kleines Fräulein.«
Menschen, die mich etwas besser kennen, könnten meinen, aus meiner Stimme eine leichte Gereiztheit zu hören. Das täuscht aber. Ich bin weiterhin gelassen wie ein Zen-Buddhist. Na gut, vielleicht wie ein Zen-Buddhist, der gerne nach Hause möchte, weil er ein bisschen friert. Die Tochter beginnt lauthals zu weinen, als hätte ich verkündet, sie werde nie wieder in ihrem Leben etwas zu essen bekommen.
Unterdessen schickt mir die Freundin eine weitere Nachricht. Sie erkundigt sich, ob alles okay sei. Ich stecke das Handy unwirsch in die Jackentasche zurück. Dass man nicht einmal ungestört alleine Zeit mit der Tochter verbringen kann, ohne pausenlos diesem WhatsApp-Terror ausgesetzt zu sein!
Ich widme mich wieder der Tochter und erkläre ihr, nachdem ich mir einen leichten Schweißfilm von der Nase gewischt habe, ganz ruhig, aber bestimmt, dass es gleich Abendbrot gäbe und dass sie sich mit einem Croissant den Appetit verderben würde. Für die Tochter eine vollkommen inakzeptable Begründung. Sie erhöht die Dezibelzahl und Tonlage ihres Weinens so deutlich, dass die Schaufensterscheiben der Bäckerei kurz vorm Zerspringen sind. Vorbeieilende Passanten halten respektvollen Abstand zu uns, weil sie befürchten, sich bei der Tochter mit Tollwut anzustecken.
Schnell gehe ich mit der Tochter in den Laden und kaufe ihr ein Croissant. Unbeteiligte könnten meine Handlungsweise unter Umständen als inkonsequent missbilligen. Ich dagegen möchte den Kauf des Croissants als Nachweis meiner Anpassungsfähigkeit verstanden wissen – eine Eigenschaft, durch die nach der Darwin’schen Evolutionstheorie überlegene Spezies ihr Überleben sicherstellen.
Leicht erschöpft, aber mit einer glücklichen, Croissant essenden Tochter erreichen wir den U-Bahnsteig. Als unsere Bahn einfährt, zeigt sich, dass die Zufriedenheit der Tochter von kurzer Dauer war. Sie bringt ihre Abneigung gegenüber dem Berliner ÖPNV resolut zum Ausdruck: »WILLE NICHT U-BAHN FAHREN.«
Ich erkläre ihr mit der Gelassenheit eines Mahatma Gandhi, der an einer fürchterlichen Migräne leidet, dass der Heimweg zum Laufen zu weit sei und wir daher die U-Bahn nehmen müssten. Wir könnten schließlich nicht fliegen. Die Tochter unterbricht ihr Heulen. Sie will jetzt fliegen. Ich mache ihr klar, dass das nicht möglich sei. Die Tochter besteht aber darauf und brüllt wieder los.
Sanftmütig wie ein Klingone beuge ich mich zu ihr runter und raune, wir könnten entweder ganz gemütlich mit der U-Bahn fahren oder wir machten es auf die harte Tour. Ein Satz wie aus einem miesen Cop-Film, der mit der Goldenen Himbeere für die schlechtesten Dialoge ausgezeichnet wurde. Ich überlege, was ich damit überhaupt meine, aber ich weiß es nicht. Die Tochter auch nicht. Sie schreit weiter. Müsste ich den Heimweg mit der Tochter mit einem Lied beschreiben, wäre es »Highway to Hell« von AC/DC.
Nachdem fünf Züge ohne uns abgefahren sind und ich aus den Unterhaltungen der Wartenden immer häufiger das Wort »Jugendamt« höre, bugsiere ich die zeternde Tochter energisch in die nächste Bahn. Beruhigend erkläre ich den anderen Fahrgästen, es bestünde kein Anlass zur Sorge, wir seien bereits auf dem Weg zum Exorzisten. Ich ernte kollektives, missbilligendes Kopfschütteln. Zum Glück fahren wir nur drei Stationen.
Passend zum suboptimalen Verlauf unserer Heimreise ist die Rolltreppe in der U-Bahn-Station defekt. Wir müssen die Treppe hochlaufen. Dies entspricht nicht den Vorstellungen der Tochter. Sie will nicht laufen, sondern ich soll sie tragen. Ich erkläre ihr, sie sei groß genug, habe gesunde Beine und könne selber laufen. Ermunternd strecke ich ihr die Hand hin, damit wir gemeinsam hochgehen.
Sie will aber nicht, und mit demonstrativ mangelndem Respekt gegenüber meiner väterlichen Autorität schlägt sie meine Hand weg. Ich erkläre ihr, dass ich dann schon mal ohne sie losgehen und oben auf sie warten würde. Sie beginnt in einer Lautstärke und Intensität zu kreischen, gegen die der Start eines Düsenjets wie ein zartes Glockenspiel anmutet.
Ich gehe wieder runter zur Tochter, um sie zu beruhigen. Da taucht ein älterer Herr auf, der die Tochter fragt, ob sie ein Stück Schokolade wolle. Mit ein paar kehligen Lauten herrsche ich ihn an, wir hätten hier alles im Griff und kämen auch sehr gut ohne seine Schokolade klar. Ich möchte nicht ausschließen, im Eifer des Gefechts eventuell auf ein paar Begriffe aus dem Reich der Ausscheidungen und der Fortpflanzung zurückgegriffen zu haben. Aber ich weise es entschieden von mir, dem eingeschüchterten Senior vorgeschlagen zu haben, er könne sich die Schokolade in eine Körperöffnung unterhalb des Steißbeins schieben, und ich wäre ihm dabei gerne behilflich. Zumindest erinnere ich mich nicht daran.
Plötzlich klingelt mein Handy. Die Freundin will wissen, wo wir denn blieben. »Jetzt nicht!«, zische ich ins Telefon. Dann belle ich noch hinterher, ich verbäte es mir, zu jeder Minute über jeden meiner Schritte Rechenschaft ablegen zu müssen. Ohne eine Antwort abzuwarten, lege ich auf.
Anschließend klemme ich mir die Tochter wie ein französisches Stangenweißbrot unter den Arm und schleppe sie die Treppe hoch. Wobei der Vergleich nicht ganz zutreffend ist, da ein Baguette erheblich weniger zappelt und kreischt.
Oben angekommen laufe ich in Dörte. Sie steht neben Konrad, der heulend auf dem Boden liegt und mit den Fäusten trommelt, als sei er vom Leibhaftigen besessen. »Das ist aber schön, euch zu sehen«, ruft Dörte und umarmt mich.
Die Tochter windet sich immer noch wie ein Aal unter meinem Arm. »Es ist doch schön, wie viel Energie die Kinder in dem Alter haben«, erklärt Dörte. Sie klingt jedoch ein wenig gestresst. Deswegen weise ich sie lieber nicht darauf hin, dass Konrad sich gerade in einem gigantischen Hundehaufen wälzt. Ich verabschiede mich und gehe mit der Tochter weiter.
Zu Hause angekommen übergebe ich die Tochter in die Obhut der Freundin und gehe ins Badezimmer. Aus dem Spiegel starrt mich ein weißhaariger Greis mit fahlem Antlitz und blutunterlaufenen Augen an. Er empfiehlt mir, gelassener zu sein, dann sei auch die Tochter entspannter. Ich schmeiße mich auf den Boden und brülle: »WILLE ABER NICHT!«


Überall erhältlich, wo es Bücher gibt.
Sie möchten informiert werden, damit Sie nie wieder, aber auch wirklich nie wieder einen Familienbetrieb-Beitrag verpassen?

Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)
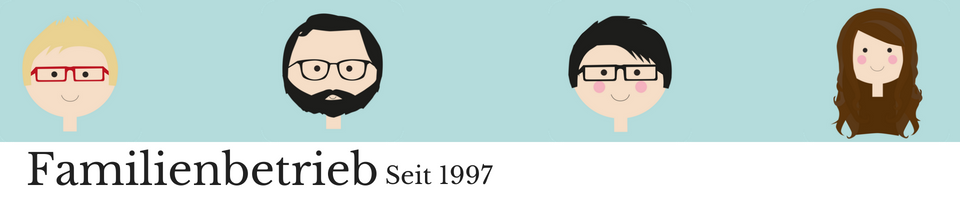
Sehr süß! Klingt ja wie auch dem richtigen Leben ;O) .
Mehr richtiges Leben geht nicht ;-)
Herrlich! Die beste Gute-Nacht-Lektüre, die ich seit langem hatte (und mein literarischer Geschmack ist ausgezeichnet). In der nächsten Situation, in der mich ein ähnliches Schicksal ereilt – was wahrscheinlich in ungefähr 6 Stunden sein wird wenn ich beim Müsli-Roulette wieder zu hoch pokere und Flocken und Milch in der falschen Reihenfolge ins Schüsselchen gebe – werde ich an diesen Post denken und mich freuen, dass ich nicht alleine bin :-)!
Vielen Dank. Und viel Glück beim Müsli-Roulette!
Es tut immer gut zu lesen, dass es bei anderen genau gleich läuft :-)
Ich habe die Jungs-Versionen davon, vor allem mein Ältester war ab 2 das Paradebeispiel des Trotzkindes. Seine Spezialität: Der hysterische Bogen. Er hat seinen Körper so durchgebogen, dass man ihn kaum tragen, geschweige denn im Auto festschnallen konnte, kombiniert mit ohrenbetäubendem Gebrüll, versteht sich. Er hat sich auch ganz gerne mal mitten auf die (zum Glück Dorf-) Strasse gelegt, am liebsten dann, wenn möglichst viele Bekannte durchfahren wollten und ihre Kommentare zum Besten gaben….
Der Mittlere ist eher der Typ Trotz-Schläger, er haut um sich und knallt Türen, dass das ganze Haus bebt.
Ich bin nun gespannt, was Nummer Drei so Neues bringt!
Liebe Grüsse und weiterhin pädagogisch viel Geduld,
Christina
Vielen Dank. Den “hysterischen Bogen” – ein schöner Ausdruck – hatten wir ab und an, wenn die Tochter in den Buggy setzen wollten.
Euch noch viel Glück mit den Trotzkindern.
LG, Christian
Wie schön zu lesen, dass wir nicht alleine sind!! Ich kann noch mit diesen nächtlichen Trotzanfällen des Nachts aufwarten, die mit Vorliebe so lange anhalten, bis garantiert das ganze Haus wach ist :-\ Alles wird gut….
Nächtliche Trotzanfälle hatten wir glücklicherweise keine. Und diese Trotzphase ist ja dann auch irgendwann vorbei gegangen.
LG, Christian
Ich habe diesen Text am Donnerstag einem Kollegen vorgelesen der wie ich auch zwei Jungs hat.
Ich hab Tränen gelacht und konnte mir das alles sehr gut bildlich vorstellen. …
Danke für die seeehr erheiternde Beschreibung eines Kindes im Trotzalter!!!
Es ist immer wieder schön, wenn man mitbekommt man ist nicht allein und auch anderen Eltern geht es so. Ich glaube ja immer noch es geht viel mehr Eltern so nur trauen sich diese nicht zuzugeben das auch ihre Engelchen Teufelchen in XXL sein können ;-)
Ich freu mich schon auf weitere so sehr nett umschriebene Alltäglichkeiten mit Kindern im Trotzalter die ihren Eltern mehr abverlangen als sie es sich jemals hätten vorstellen lassen!! Und gleichzeitig liebt man sie wie nichts anderes auf der Welt. .. irgendwie komplett verrückt! Aber das liegt bei vielen wohl eher an dem fehlenden Rückgabe- und Umtauschrecht… ;-)
Ich werde mich nun weiter Tag für Tag überraschen lassen was meine zwei Jungs (2 & 4 Jahre) noch so alles aus ihrer Trotzkiste zur Verfügung stellen um uns immer wieder aufs Neue auf die Probe zu stellen. …
In diesem Sinne viel Spaß allen Eltern von Kindern im Trotzalter!
Vielen Dank. Die Natur hat sich das mit dem Kindcheschema gut ausgedacht, so dass Eltern ihren Kindern doch sehr viel verzeihen. Auch die Trotzphase.
LG, Christian
Liege gerade neben meinem Sohn, wartend dass er einschläft, und lese dabei diesen Beitrag. Fataler Fehler: muss so lachen, dass Sohn immer wieder aufwacht und mich verwundert anguckt. Super witzig geschrieben! You made my day :-)
Love it!
Wenn ich den Text jetzt noch auf Englisch fände, was alleine der einzigartigen Wortwahl wegen absolut unmöglich sein dürfte (oder zumindest im Ergebnis niemals ebenbürtig), könnte ich meinem besonders empathischen guten Bekannten (nicht deutschsprachig, kinderlos) vom Strandtag vorgestern vielleicht etwas besser erklären, warum ich ihn für sein dämliches Lachen um ein Haar gegrillt hätte.
Seis drum.
Hab gehört, mit 20 wird das besser?