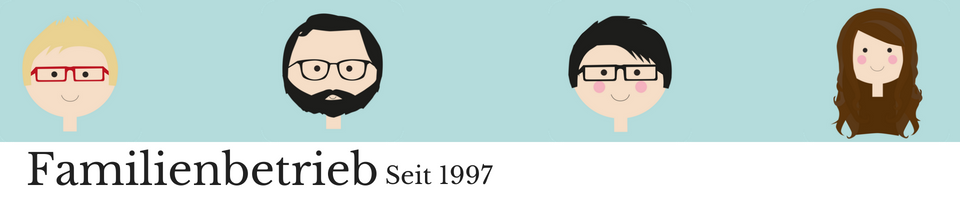Es ist Freitagnachmittag und ich stehe in der Hutabteilung eines großen Berliner Kaufhauses. Sicherlich denken Sie jetzt, der Mann ist doch noch viel zu jung, um sich einen Hut zu kaufen und da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht.
Heute Morgen beim Frühstück erzählte die Frau aber, sie habe kürzlich in der Zeitung gelesen, wie wichtig beim Strandurlaub eine gute Kopfbedeckung sei, um Melanome auf der Kopfhaut zu vermeiden. „Das ist nicht nur für Glatzköpfige wichtig, sondern auch für Männer mit schütterem Haar“, erklärte sie und schaute mich dabei besorgt an. „Das ist ja sehr interessant“, erwiderte ich. „Aber was geht mich das an?“ Als Antwort zieht die Frau lediglich die linke Augenbraue hoch. Das international übliche Zeichen für „Really?“
Dazu müssen Sie wissen, dass die Frau seit mehreren Jahren immer wieder andeutet, bei mir sei eine fortschreitende Glatzenbildung zu beobachten. Das ist allerdings Unsinn. Ich habe sehr volles Haar. Zumindest an den meisten Stellen. Die Frau macht das nur, um von ihren rapide ergrauenden Haaren abzulenken. Ihr zuliebe färbe ich mir inzwischen heimlich den Bart grau. Wenn wir zum Beispiel Einkaufen gehen, sollen die Leute ja nicht denken, da sind Enkel und Großmutter gemeinsam unterwegs.
„Du hattest letztes Jahr in Griechenland einen ziemlichen Sonnenbrand auf dem Kopf“, erinnerte mich die Frau. „Du musst dich besser schützen, damit du keinen Hautkrebs bekommst. Ich möchte doch gemeinsam mit dir alt werden. Selbst wenn du eine Glatze bekommst.“
Ich ignorierte ihre geradezu ehrabschneidende Unverschämtheit und nahm einen großen Schluck Kaffee. „Schade, dass die Zeit zu knapp ist, damit mir meine Eltern den alten Lederhut schicken, den ich mir damals als Fünfzehnjähriger in Südfrankreich gekauft habe“, sagte ich enttäuscht. „Der coole, der so aussieht, als habe Crocodile Dundee ihn getragen. Weißt du, welchen ich meine?“ Die Frau schien es zu wissen und ihr war die Erleichterung anzumerken, dass er 600 Kilometer entfernt bei meinen Eltern auf dem Speicher liegt.
###
Nun stehe ich also hier im Kaufhaus, um mir eine Kopfbedeckung für den Urlaub auszusuchen. Nicht weil ich schütteres Haar habe, so dass meine Kopfhaut extra geschützt werden muss – jeder der das Gegenteil behauptet, wird Post von meinem Anwalt erhalten –, sondern um des lieben Ehefriedens willen. Man möchte die Reisevorbereitungen ja nicht durch unnötige partnerschaftliche Disharmonien belasten.
Die immense Auswahl an Hüten, Kappen und Mützen überwältigt mich. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen, Farben und Materialien. Allerdings lassen sie ästhetisch einiges zu wünschen übrig. Wahrscheinlich stehen Hutdesigner am untersten Ende der Modeschöpfer-Hierarchie.
„Kann ich Ihnen behilflich sein?“, fragt mich eine junge Verkäuferin. Normalerweise hasse ich es, in Verkaufsgespräche verwickelt zu werden, aber da sie außerordentlich attraktiv ist, fällt mir mein übliches „Danke, ich schaue mich erst einmal um.“ nicht ein. „Ich suche nach einer Kopfbedeckung für den Strand“, erwidere ich stattdessen. Sie nickt verständnisvoll. „Das ist wirklich wichtig, im Sommer einen Hut zu tragen, wenn das Haar nicht mehr ganz so dicht ist. Sie wissen schon, wegen der Hautkrebsgefahr.“ Ich drehe mich um, um zu sehen, ob sie gerade mit jemand anderem spricht. Tut sie aber nicht. Wahrscheinlich ist sie noch in der Ausbildung und muss erst lernen, wie man die Kundschaft höflich und respektvoll behandelt.
Sie schaut sich kurz um und reicht mir dann einen Panama-Hut. So einen Strohhut pflegte mein verstorbener Schwiegervater zu tragen. Der war allerdings auch weit über 60 und hatte tatsächlich eine Glatze. Ich dagegen bin Anfang 40 – bei günstigem Licht (das heißt, bei totaler Dunkelheit), werde ich sogar häufig auf Ende 30 geschätzt – und habe, wie Sie inzwischen wissen sollten, sehr kräftiges Haar. Allenfalls bei sehr ungünstigem Licht (das heißt, bei allem, außer totaler Dunkelheit) entsteht bei mir nicht wohlgesonnenen Zeitgenossen der falsche Eindruck, es dünne an einigen sehr wenigen Stellen aus. Folglich ist ein Panama-Hut keine passende Kopfbedeckung für mich. Ich probiere ihn trotzdem auf und betrachte mich im Spiegel. Ein fröhlicher Greis lacht mich an. Ich sollte aufhören, mir den Bart grau zu färben. Und keine Panama-Hüte tragen.
„Der steht Ihnen wirklich ausgezeichnet“, zeigt sich die Verkäuferin begeistert. Sie ist jung und hübsch, aber eine schlechte Lügnerin. „Das ist eher nichts für mich“, erwidere ich. „Ich bin ja noch keine 50.“ „Ach so“, sagt die Verkäuferin und kann ihre Überraschung kaum verbergen. Eine Karriere in der Einzelhandelsbranche, in der Fingerspitzen- und Taktgefühl gegenüber den Kunden gefragt ist, scheint mir für die junge Frau nicht ganz das Richtige zu sein.
„Wie wäre es mit einem Strandkäppi?“, schlägt sie vor. „Die sind schön luftig und zeitlos modern.“ Das letzte Mal habe ich so etwas im Urlaub getragen, als ich ungefähr drei war. Damals war das recht niedlich, heute sehe ich damit eher aus wie ein „Man spricht deutsch“-Komparse.
„Das ist mir auch zu altbacken“, schüttele ich den Kopf. „Vielleicht sollte ich mich mal in der Jugendabteilung umschauen.“ Die Verkäuferin hebt ihre linke Augenbraue. Warum haben heute eigentlich alle Frauen ihre Gesichtszüge nicht unter Kontrolle?
Bei der Jugendmode werde ich ebenso wenig fündig und versuche mein Glück in der Sportabteilung. Als erstes schaue ich mir einige Basketball-Kappen an. Die sind allerdings alle so unförmig hoch und man sieht immer etwas bescheuert damit aus. Gangsta-Rapper können das vielleicht tragen. Bei denen sieht das zwar auch bescheuert aus, aber das sagt ihnen niemand, weil sie einem sonst eine reinhauen. Als NBA-Profis kann man auch so eine Kappe tragen. Da ist man Multimillionär und es kann einem vollkommen schnuppe sein, dass man wie ein Vollidiot rumläuft. Zumindest ist man dann nämlich ein sehr reicher Vollidiot. Da ich weder meinen Mitmenschen, die sich kritisch über meine Klamottenauswahl äußern, die Fresse poliere, noch Profisportler und Multimillionär bin, muss ich mir eine andere Kopfbedeckung aussuchen.
Vielleicht ein Baseball-Cap. Die sehen etwas schicker aus als ihre Basketball-Brüder. Allerdings ist es auch oberpeinlich, eine Kappe von irgendeinem Baseball-Verein zu tragen, von dem man nicht einmal weiß, wo er überhaupt liegt. Dabei fällt mir ein, dass ich mit 16 für drei Wochen in den USA zum Schüleraustausch war und mir ein Trikot der St. Louis Cardinals kaufte. Ich hätte zwar große Schwierigkeiten gehabt, St. Louis auf einer Landkarte der USA zu verorten, aber mir gefielen die rot-beigen Vereinsfarben. (Schon damals hatte ich keinen sonderlich guten Geschmack.) Getragen habe ich das Trikot aber nie, noch nicht einmal zu Fasching, denn es war mir viel zu groß. Damals hoffte ich noch, erheblich an Muskelmasse zuzulegen, was in den 25 Jahren, die seitdem vergangen sind, aber nie passiert ist. Weggeworfen habe ich das Shirt trotzdem nie. Statistisch gesehen müsste ich ja allmählich in die Midlife-Crisis kommen und vielleicht exzessiv ins Fitness-Studio gehen. Dann werde ich froh sein, wenigstens ein passendes Hemd zu haben.
Da ein Baseball-Cap auch nicht infrage kommt, entscheide ich mich schließlich für eine neutrale weiße Kappe, wie sie Tennisspieler tragen. Die steht mir zwar auch nicht sonderlich gut, aber sie ist unauffällig genug, dass ich damit nicht zum Gespött des sardischen Strandes werde. Zumindest hoffe ich das.
###
Auf dem Heimweg gehe ich noch zum Friseur. Früher habe ich mir immer am Urlaubsort die Haare schneiden lassen. Quasi als Beitrag zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft. Seit es in Holland aber mal größere Verständigungsprobleme gab und ich zwei Wochen lang wie GI Joe rumlaufen musste, vertraue ich lieber meinem arabischen Stammfriseur. Der ist flink mit der Schere und, weil er die deutsche Sprache nicht sonderlich gut beherrscht, sehr schweigsam. Zwei Eigenschaften, die ihn mir sehr sympathisch machen. Vielleicht ist er aber auch gar kein Araber, sondern in Moabit aufgewachsen und tut nur so als spräche er kein Deutsch, weil er kein Bock hat, sich mit mir zu unterhalten. Das würde ihn mir noch sympathischer machen.
Der arabische Figaro legt gleich los wie Edward mit den Scherenhänden und kürzt flink das Haar auf meinem Kopf und auch gleich an allen anderen Stellen oberhalb des Halses. Ein sehr guter Freund hat mir einmal den Ratschlag gegeben, wenn der Friseur einen fragt, ob er auch die Augenbrauen schneiden soll, solle man dies immer bejahen, denn er wird schon seinen Grund haben. Der arabische Friseur fragt mich aber gar nicht erst, sondern bearbeitet beherzt mit Kamm und Schere den Wildwuchs über meinen Augen. Bisher hatte ich mir immer eingebildet, über die filigran gezupften Augenbrauen eines Cristiano Ronaldos zu verfügen, aber anscheinend sehe ich eher aus wie der Träger des Theo-Weigel-Gedächtnispreises.
Anschließend widmet sich der arabische Friseur meinem Bart, den er mit der Schneidemaschine akkurat stutzt. „Mache zwei Millimeter“, radebrecht er. „Wie bei junge Leute.“
Währenddessen kommt es auf dem Nachbarstuhl fast zum Eklat. Ein junger Kunde in den frühen Zwanzigern ist unzufrieden mit der Länge seiner Haare. „Alter, hab isch doch gesagt, du sollst nicht schneiden so kurz“, mosert er. „Will so haben wie bei Kollegen.“ Dabei zeigt er auf mich. Anscheinend sind meine Haare die neue Referenzfrisur unter den arabischen Halbstarken im Kiez. Ich sehe eine glänzende Karriere als Babo von Moabit vor mir.
Inzwischen ist der arabische Friseur fertig bei mir, föhnt die abgeschnittenen Haare von meinen Schultern und onduliert meine oberen Haupthaare mit der Rundbürste. „Obe bisschen länger, habe gekämmt so, dass keine Lücken“, erklärt er stolz. Sein Deutsch ist wirklich sehr schlecht und er kennt halt die Vokabeln für „Sie haben tolles, kräftiges Haar“ nicht. So lange er gut Haare schneidet, soll mir das egal sein.
Als ich nach Hause komme, begutachtet die Frau sowohl Haarschnitt als auch Kappe und nickt wohlwollend. Hier gilt wohl das Motto „Net gschimpft isch globt gnug.“
###
Nach dem Abendessen wird es Zeit, dass ich endlich meine Klamotten für den Urlaub raussuche. Die Frau hat schon vor Tagen damit begonnen, systematisch Kleidungsstücke von sich und den Kindern sowie weitere Urlaubsutensilien zu richten. Bei der Urlaubsvorbereitung ist sie wirklich extrem gut organisiert. Übertrüge man ihr die Bauleitung für den BER, er wäre spätestens zum Jahresende fertig.
Ich inspiziere unsere Wohnzimmertisch, wo die Frau alles gestapelt hat. Kurze Hosen, lange Hosen, T-Shirts, Unterhosen, Unterhemden, dünne Pullover, dicke Pullover, Handtücher, Strandtücher, Badehosen, Taucherbrillen, Schnorchel, Strandlatschen, Laufschuhe, Sonnenmilch, Kosmetika, Bücher, ein paar Spiele und noch viel mehr. Sieht ein wenig aus wie auf einem Krabbeltisch bei kik im Sommerschlussverkauf.
Ich selbst bin ein wenig unschlüssig, was ich alles mitnehmen soll, denn ich bin überzeugt, damit entscheidenden Einfluss auf das Wetter an unserem Urlaubsort auszuüben. Genau wie ein Schmetterlingsflügelschlag in Brasilien einen Tornado in Texas auslösen kann, determiniert meine Klamottenauswahl die Temperaturen auf Sardinien in den nächsten zwei Wochen. Wenn ich mich auf kurze Hosen und T-Shirts beschränke, wird es zu einem noch nie dagewesenen sommerlichen Wintereinbruch kommen, packe ich aber mehrere lange Hosen und Sweatshirts ein, wird es eine 14-tägige Dürreperiode geben, gegen die die Wüste Gobi ein sumpfiges Feuchtbiotop ist.
Ich erzähle der Frau von meinem Problem und schlage vor, einige lange Hosen mitzunehmen, die ich am ersten Tag gleich wegwerfe. Dann müssten wir eigentlich ein sehr angenehmes Klima im Urlaub haben. Die Frau meint, wenn ich schon Klamotten entsorgen wolle, dann doch lieber meine sackartigen Strandshorts und zwar am besten noch vor dem Urlaub. Morgen Vormittag wäre ja noch genug Zeit, ein paar neue zu besorgen. Ich erkläre, das sei ausgeschlossen, denn wenn ich morgen schon wieder einkaufen gehen müsste, würde ich einen Shopping-Burn-out erleiden. Die Frau zieht wieder ihre linke Augenbraue hoch. Sie muss wirklich etwas gegen diese unkontrollierten Gesichtszuckungen unternehmen. Anscheinend braucht sie dringend Erholung. Da kommt der Urlaub gerade recht.
Gute Nacht!
###
Alle Teile des Sardinien-Tagebuchs finden sie hier.

Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)