Der (fast) alljährliche Urlaubsblog. Diesmal nicht live, aber dafür in Farbe und HD. Zur besseren zeitlichen Orientierung sei erwähnt, dass der Urlaub Ende Juni / Anfang Juli stattfand. Die kompletten Beiträge finden Sie hier.

Eine Radtour, die ist lustig, aber nur ein kleines bisschen
„Ich habe da eine super App empfohlen bekommen, mit der kannst du dir ganz einfach Radtouren zusammenstellen.“ Das hatte die Frau vor ein paar Wochen beim Abendessen in Berlin gesagt. Die Kinder und ich schauten uns alarmiert an. „Für Föhr habe ich schon mal einen schönen Rundkurs rausgesucht“, fuhr sie ungerührt fort. Unser Unbehagen wuchs und wir rutschten nervös auf unseren Plätzen hin und her, was die Frau aber gekonnt ignorierte. „Sind auch nur 40 Kilometer.“ Das war der Moment, als wir richtig panisch wurden, denn mit Familien-Radausflügen haben wir nur so mittelmäßig gute Erfahrungen gemacht.
Da die Temperaturen heute mal wieder eher ins Herbstliche spielen, es aber wenigstens nicht regnen soll, beschließen wir, es heute mit der Radtour anzugehen. Wobei „beschließen wir“ vielleicht etwas zu sehr nach gemeinschaftlich getroffener Entscheidung klingt. Tatsächlich schlug die Frau die Radtour vor, und da uns anderen außer „Muss das wirklich sein?“ kein gutes Gegenargument und auch kein besserer Vorschlag für eine alternative Freizeitgestaltung einfielen – mit seiner Idee, den ganzen Tag am Handy zu zocken, konnte sich der Sohn nicht durchsetzen –, liehen wir also Räder aus und machten uns auf den Weg.
Im Feldversuch stellt sich heraus, dass die „super App“ doch nicht ganz so super ist. Wir sind noch nicht wahnsinnig lang unterwegs, da hat die App uns schon zum siebten Mal zum Umdrehen aufgefordert. Es ist nicht auszuschließen, dass dies damit zusammenhängt, dass die Frau, die vorneweg fährt, direkt am Anfang falsch losgefahren ist. Die App will sich aber partout nicht darauf einlassen, den Rundkurs aus der anderen Richtung zu befahren, sondern weist uns beharrlich darauf hin, wir mögen bitte umkehren. Die Frau hält an, fummelt hektisch am Handy rum, murmelt ein paar unterdrückte Flüche und fährt schließlich mit den Worten „Das müsste eigentlich auch gehen.“ wieder los.
Ich weiß ja nicht, wie Ihnen das geht, aber bei einer Routenplanung finde ich die Verwendung des Konjunktivs und dann noch in Verbindung mit dem Wort „eigentlich“ nicht sehr vertrauenserweckend. So willkürlich, wie die Frau die nächsten Abzweigungen nimmt, habe ich zeitweise das Gefühl, sie würfelt das aus. Es würde mich nicht wundern, wenn sich unsere 40km-Radwanderung zu einer stattlichen Tour-de-France-Etappe auswachsen würde. (Dazu müssten wir die Insel zwar vier- bis fünfmal umrunden, aber zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich das nicht ausschließen.)
Aber ich sollte mich nicht beschweren. Schließlich könnte ich selbst unser kleines Peloton anführen und mir von der App den Weg weisen lassen. Tue ich aber nicht. Das würde nämlich auch nicht viel ändern. Sehr wahrscheinlich würde es die Situation noch verschlimmern. Ich verfüge nämlich über den Orientierungssinn einer Stubenfliege mit Links-rechts-Schwäche und chronischem Schwipp-Schwindel.
Landkarten sind mir auch keine große Hilfe. Ich kann Entfernungen nicht abschätzen, brauche ewig, bis ich meinen Standort finde – „ewig“ ist hier übrigens wörtlich zu verstehen –, und halte die Karte prinzipiell erstmal falsch rum. Falls es so etwas wie eine Landkarten-Leseschwäche gibt, habe ich sie definitiv.
Daher sind Navigationssysteme für mich eine segensreiche Erfindung, denn es ist für mich eine riesige Erleichterung, wenn mir jemand vorsagt, wie ich von A nach B komme. Allerdings auch nicht immer. Wenig hilfreich ist es zum Beispiel, wenn das Navi sagt: „Fahren Sie Richtung Norden zur Ludwig-Klein-Allee.“ Wo zur Hölle soll die Ludwig-Klein-Allee sein? Wenn ich das wüsste, bräuchte ich das Navi wahrscheinlich gar nicht. Und woher soll ich bitteschön wissen, wo Norden ist? Bin ich ein verdammter Kompass, oder was? Warum sagt es nicht gleich „Fahren sie grob Richtung 52° 31′ 50.995″ N 13° 20′ 45.154″ E, dann werden Sie Ihr Ziel mit etwas Glück erreichen. Fragen Sie zur Not unterwegs nochmal nach.“
Nach rund 20 Minuten Radelei kann festgehalten werden: Der Spaßfaktor unseres Familien-Ausflugs ist ausbaufähig. Die ansonsten sehr resiliente Frau wirkt leicht angespannt, weil sie sich von der App gegängelt fühlt, die Tochter klagt, ihre Handgelenke täten wegen des komischen Lenkers weh, der Sohn merkt an, dass Radfahren doch weniger Spaß macht, als er vorher gedacht hat – und ich glaube, seine Erwartungen diesbezüglich waren schon nicht besonders hoch –, und ich denke derweil darüber nach, dass wir für die Drei-Tage-Leihgebühr für die vier Räder fast 100 Euro bezahlt haben. Eigentlich hätte ich das Geld auch verbrennen können. Dann wäre der Schein zwar auch futsch, aber wir hätten zumindest weniger Stress.
Wer auch keinen guten Tag hat, ist die Fahrrad-App. Sie fragt sich gerade bestimmt, warum sie nichts Ordentliches geworden ist, zum Beispiel Fortnite Battle Royal oder FIFA mobile. Halt irgendetwas, was den User:innen Spaß macht, und wofür sie der App dann eine Masse 5-Sterne-Ratings geben. Stattdessen muss sie vier vollkommen plan- und orientierungslose Vollhonks, deren intellektuellen Informationsverarbeitungsfähigkeiten nicht einmal dazu ausreichen, um die einfachsten Anweisungen zu befolgen, über eine Nordseeinsel lotsen.
Wahrscheinlich macht die App heute die fünf Phasen der Trauer durch:
- Leugnen: „Nein, dass kann nicht sein, dass die jetzt zum fünften Mal genau in die entgegengesetzte Richtung gefahren sind, als ich angesagt habe. Das ist einfach nicht möglich, das kann nicht wahr sein. Nein, nein, nein!“
- Wut: „Habt ihr Penner die falsche Spracheinstellung gewählt und ihr lasst mich die ganze Zeit Esperanto labern, so dass ihr mich nicht versteht? Oder denkt ihr Dumpfbrumsen so langsam, dass ihr schon an der Kreuzung vorbei seid, wenn die Information in eurem Gehirn ankommt, dass ihr abbiegen müsst? Trottel!“
- Verhandeln: „Einmal, nur einmal könntet ihr doch darauf hören, was ich euch sage. Das wäre voll nett. Ich könnte euch auch den Weg zu einer Eisdiele zeigen.“
- Depression: „Warum? Warum ich nur? Wir werden nie wieder Zuhause ankommen, irgendwann ist der Akku leer und das war’s dann mit mir.“
- Akzeptanz: „Ach, fuck it, ich sage einfach irgendwas. Ihr rafft es ja sowieso nicht. Wird schon schiefgehen.“
Nach knapp drei Stunden erreichen wir schließlich wieder unsere Ferienwohnung. „Sie haben ihr Ziel erreicht“, verkündet die Rad-App und seufzt vor Erleichterung. Und wenn ich mich nicht täusche, höre ich noch ein leises: „Und jetzt deinstalliert mich bitte!“

Grab! Ein! Loch!
Die Temperaturen sind zwar immer noch nicht so prickelnd, aber wir gehen trotzdem nochmal an den Strand. Dort sehe ich von Weitem Grinse-Ole und seine Familie. Seine Frau sitzt mit dem Baby im Strandkorb, er spielt mit den beiden größeren Kindern, die circa drei und sechs sind. Das Spiel scheint eine Art Manchester-Kapitalismus-im-frühen-19.-Jahrhundert-Live-Simulation zu sein. Grinse-Ole muss die Rolle des ausgebeuteten Arbeiters übernehmen, seine Kinder sind tyrannische Fabrikbesitzer:innen. Gerade ist Grinse-Ole dabei, ein Loch zu graben. Er fragt, wie tief er buddeln soll, der Sohn sagt lapidar: „Bis du unten bist.“ Gut, die Angabe ist etwas unpräzise, aber da die Tochter die ganze Zeit ruft: „Grab‘, Papa, grab‘!“, weiß Grinse-Ole zumindest, dass er noch lange nicht fertig ist.
Nachdem die beiden der Meinung sind, dass er genug gegraben hat, nötigen sie ihn, mit einem Eimer, Wasser aus dem Meer zu holen und in das Loch zu schütten. Seinen Einwand, das Wasser würde immer im Sand versickern, lassen sie nicht gelten: „Ist doch nicht schlimm, das macht trotzdem Spaß!“ Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Grinse-Ole dieser Aussage uneingeschränkt zustimmt, denn er ist es, der dutzende Male und immer mit einem Kind auf den Schultern oder dem Arm zum Meer latschen muss. Aber Ole soll das Ganze einfach positiv sehen: Das Lochgraben und Wasserholen ist ein spitzen Work-out und hilft ihm dabei, in Form zu bleiben. Zugegebenermaßen eine rosarote Sichtweise, die einem recht leicht fällt, wenn du im Strandkorb sitzt und keine Löcher buddeln und kein Wasser schleppen musst.
Das mysteriöse Tatoo
Auch gut in Form ist der Typ, der sich ungefähr fünfzehn bis zwanzig Meter vor unserem Strandkorb mit seiner Freundin niedergelassen hat. Bei den beiden erkenne selbst ich, dass sie nicht unser Alter sind, sondern schätzungsweise fünf Jahre jünger. (Also 20).
Der Typ hat ein ziemliches beeindruckendes Tattoo, das sich über seinen gesamten Brustkorb erstreckt. Ungefähr in der Mitte, wo der Solarplexus ist, leuchtet etwas rötlich. Aus der Entfernung kann ich leider nicht erkennen, was das Tattoo genau darstellt. Es könnte ein großer Greifvogel mit ausgebreiteten Schwingen sein, und was da leuchtet, ist vielleicht sein Schnabel. Oder es ist ein Suchbild und der rote Punkt ist Walter, den der Typ schon seit Jahren erfolglos auf seiner Brust sucht.
Möglicherweise hatte der Tattoo-Artist aber einfach einen sehr lange andauernden Schluckauf und hat unkontrolliert Kringel und Kreise in den Oberkörper gestochen. Das kann auch gut sein.
Stadt, Land, Stuss
Nach dem Abendessen spielen wir „Stadt, Land, Vollpfosten“. Das funktioniert wie das normale „Stadt, Land, Fluss“ nur mit etwas außergewöhnlicheren Kategorien. Zu meinem Leidwesen sind aber Stadt, Land und Fluss als Kategorien gesetzt. Fluss ist der totale Horror für mich. Meine Erdkunde-Kenntnisse sind jetzt zwar nicht so ausgeprägt, dass ich mich Jemandem als Wer-wird-Millionär-Telefonjoker für Geographiefragen aufdrängen würde, aber meine Allgemeinbildung bewegt sich durchaus auf Kreuzworträtsel-Niveau und reicht für gängige Flüsse wie Rhein, Mosel und Donau. Spree, Isar und Alster sind mir ebenfalls bekannt. Zumindest normalerweise. Nicht aber unter dem Druck eines „Stadt, Land, Fluss“-Spiels. Dann ist der Bereich meines Gehirns, in dem die Flüsse abgespeichert sind, plötzlich total leer. Vollkommen blank. Da ist nichts mehr. Nada, nothing, rien, niente, niets, ничего, なんでもない, 毫无.
Wahrscheinlich rührt meine Fluss-Phobie und -Amnesie daher, dass ich im Alter von circa neun oder zehn auf einem Paddelausflug mit einer befreundeten Familie im Altrhein gekentert bin. So ein traumatisches Erlebnis kann einen beim „Stadt, Land, Fluss“-Spielen schon mal blockieren.
Die anderen Kategorien, die wir auswählen und mit denen ich hoffe, meine Fluss-Schwäche wettzumachen, sind die folgenden:
- Säugetiere
- Schimpfworte
- Was man heimlich macht
- Kündigungsgrund
- Trennungsgrund
Die Säugetiere-Kategorie ist natürlich etwas lame, bietet aber gute Anknüpfungspunkte für die anderen Kategorien, wie Sie gleich sehen werden. Zum Beispiel für die Kategorie Schimpfworte. Da kombinierst du die Tiere einfach mit einem ordinären Ausdruck für Hintern und schon hast du eine 1a-Beleidigung: Igelarsch, Eselarsch, Ponyarsch, Otterarsch, Stachelschweinarsch, Ziegenarsch und so weiter. Die anderen finden das zwar wenig originell, aber da sie die Frage verneinen, ob sie es für ein Kompliment hielten, wenn ich sie Dromedararsch nennen würde, zählen meine Antworten.
Die Sachen, die die Kinder in der Was-man-heimlich-macht-Kategorie aufschreiben, klingen wiederum ein wenig, als hätte sich die Dr.-Sommer-Redaktion zum Brainstorming getroffen: Onanieren, Masturbieren, Fummeln, Fellatio, Petting oder Züngeln. Wenigstens scheinen sie im Sexualkundeunterricht aufgepasst zu haben.
Längere Diskussionen gibt es, als die Frau in dieser Kategorie Fechten einträgt. Sie erklärt, wenn du nicht fechten kannst, möchtest du dabei nicht gesehen werden und machst das deswegen immer nur heimlich. Das ergibt durchaus Sinn. Das ist auch der Grund, warum Sie mich in der Öffentlichkeit niemals beim Yoga, Square Dancing oder Hummer essen sehen.
Ich lasse mich für die Was man heimlich macht-Kategorie wieder von den Säugetieren inspirieren. Igel küssen, Esel küssen, Pony küssen, Otter küssen, Stachelschweine küssen, Ziegen küssen. Die anderen finden das zwar grenzwertig, aber stimmen mir zu, dass du definitiv nicht dabei beobachtet werden willst, wie du ein Frettchen küsst. Eine super Strategie von mir. Trotzdem sollte ich mich vielleicht mal mit einem Therapeuten unterhalten. Bestimmt hängt diese Tiere-küssen-Obsession damit zusammen, dass mir meine Eltern früher kein Haustier erlaubt haben.
Besonders genial ist aber mein Schachzug, die Antworten aus der Heimlich-machen-Kategorie einfach auch bei Kündigungsgrund und Scheidungsgrund einzutragen. Erneut gibt es Proteste vom Rest der Familie, aber ich kann überzeugend argumentieren, dass du ja wohl deinen Job verlieren wirst, wenn du auf der Arbeit einen Esel küsst. (Insbesondere, wenn du Tierpfleger bist.)
Bei der Kategorie Scheidungsgrund sage ich zur Frau, dass sie sich sicherlich von mir trennen würde, wenn ich ein Stachelschwein küssen würde. Darauf entgegnet sie, mit Hinblick auf meinen Bart, könne durchaus argumentiert werden, dass sie seit über 20 Jahren sogar Sex mit einem Stachelschwein hat, und ich mich ja auch nicht scheiden lassen würde. Die Kinder wissen nicht so recht, ob sie lachen oder sich übergeben sollen. Vielleicht sollten wir doch lieber etwas anderes als „Stadt, Land, Fluss“ spielen.
Unser tägliches Kniffel-Spiel gib uns heute
Return of the Tochter, die nach der Corona-Kniffel-Challenge auch die Urlaubs-Challenge für sich entscheiden will. Und nein, die Frau hat entgegen anderslauternder Meldungen nicht eine Runde ausgesetzt.

Sie möchten informiert werden, damit Sie nie wieder, aber auch wirklich nie wieder einen Familienbetrieb-Beitrag verpassen?

Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)
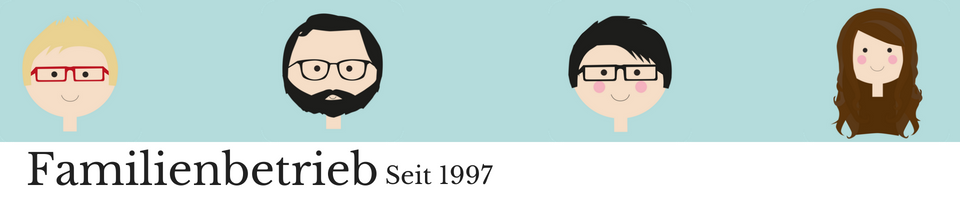

Likes
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Dieser Article wurde erwähnt auf brid-gy.appspot.com
Neuveröffentlichungen
Corona-Föhrien – Tag 6: Wir machen eine Fahrradtour zum Leidwesen der Rad-App, Grinse-Ole muss am Strand schuften, es gibt ein mysteriöses
Erwähnungen
Friday, I’m in love with @Betriebsfamilie