Dass ich dieses Jahr so gut wie gar nichts gebloggt habe, ist ja kein Zustand. Kein Urlaubsblog, kein Gespräch mit dem Tod, kein Garnichts. Daher kurz vor Schluss ein retrospektiver Krankenhaus-Blog. Quasi wie Urlaub, nur ohne Urlaub.
Tag 1: Ein kaputtes Herz muss man reparieren
Tag 2: Don’t go breaking her heart
Mittwoch, 6.55 Uhr. Ich schreibe den Kindern eine Nachricht, ob bei ihnen alles in Ordnung ist. Sie reagieren nicht, aber das ist kein Grund zur Besorgnis. Die Kinder ignorieren immer meine Fragen auf WhatsApp. Oder sie antworten drei Tage später mit einem Daumen-hoch-Emoji, ganz egal, was die Frage war.
Nach dem Duschen versuche ich, in meiner Vier-Quadratmeter-Hotel-Box, die keinen Schrank hat, Ordnung zu schaffen. In der Ecke vor dem Waschbecken richte ich eine Schmutzwäschen-Zone ein, die Ecke vor der Eingangstür wird zur Wechselklamotten-Zone. Allerdings ist das Zimmer so klein, dass die beiden Zonen fließend ineinander übergehen. Die schmutzige Wäsche breitet sich unaufhaltsam aus und droht, die Wechselklamotten-Zone zu okkupieren. Ich trenne beide Bereiche mit dem Koffer meiner Frau, den ich gestern aus dem Krankenhaus mitgenommen habe. Er ist quasi die neutrale Zone. Wie zwischen Süd- und Nordkorea. (Sie dürfen selbst entscheiden, ob Nordkorea die Schmutzwäsche-Zone und Südkorea die Wechselklamotten-Zone ist oder umgekehrt.)

Die komplette Bodenfläche ist nun mit Wäsche bedeckt. Um das Zimmer zu verlassen, muss ich über das Bett klettern und mich am Fußende unter der Treppe, die zur Dusche führt, hindurchquetschen. Somit habe ich mir in meinem Low-Budget-Hotel ein eigenes Gym erschaffen. Toll!
Im Empfangsbereich des Hotels genehmige ich mir wieder einen kostenlosen Kaffee. Ein anderer Gast bedient sich ebenfalls an der Pumpkanne. Er nippt an seinem Becher und beschwert sich lautstark über die miese Qualität des Kaffees. Mein linkes Auge beginnt zu zucken. Schon bei der Begrüßung war mir der Mann unangenehm aufgefallen. Er hatte mir übertrieben höflich und mit einer für die frühe Stunde geradezu ekelerregenden Fröhlichkeit einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Was stimmt mit dem Typ nicht?
Mit seiner Äußerung über die geschmacklichen Unzulänglichkeiten des Kaffees signalisiert er, dass er auf einen morgendlichen Plausch aus ist. Er sagte nämlich wortwörtlich: „Das ist aber eine dünne Plörre, oder?“ Nicht als einfache Feststellung – „Das ist aber eine dünne Plörre.“ –, die du geistesabwesend vor dich hinbrabbelst. Nein, durch das „oder“ und die steigenden Intonation am Satzende hat er die Aussage in eine Frage verwandelt. So erwartungsvoll wie er mich jetzt anschaut, möchte er anscheinend eine Antwort von mir.
Das kommt mir äußerst ungelegen. Ich möchte morgens nicht reden. Nicht einmal mit meiner Familie, aber schon gar nicht mit einem fremden Mann im Foyer eines Billig-Hotels.
Fieberhaft suche ich in meinem Hirn, das morgens eher untertourig läuft, nach einer Erwiderung, mit der ich das zarte Small-Talk-Pflänzchen im Keim ersticken kann. Ich könnte schlicht „Halt einfach deine verdammte Fresse!“ sagen. Trotz meines Unwillens zur morgendlichen Konversation möchte ich aber nicht wie ein sozial vollkommen inkompetenter Unflat erscheinen.
Schließlich sage ich: „Naja, einem geschenkten Kaffeegaul, schaut man nicht ins Maul.“ Eine brillante Bemerkung, wie ich finde. Sprachlich gewitzt stelle ich mich als genügsamen Menschen dar, der sich demütig über ein Gratis-Heißgetränk freut. Der Morgen-Dampfplauderer steht jetzt dagegen als undankbarer Nassauer da, der sich kleinlich darüber aufregt, dass ihm in dem 25-Euro-die-Nacht-Hotel kein kostenloser Venti Vanilla Sweet Cream Cold Brew mit extra Espresso, extra Sahne und laktosefreier Milch kredenzt wird.
Meine Antwort zeigt die erhoffte Wirkung. Der Mann verlässt gruß- und wortlos das Hotel. Ich mache mich auf den Weg ins Klinikum und trinke schweigend meinen Kaffee.
Als ich den Eingangsbereich des Krankenhauses erreiche, erblickt mich der Kioskbesitzer. Freudestrahlend winkt er mir – seinem neuen Lieblingskunden – zu. Obwohl ich meinen Kaffee gerade erst ausgetrunken habe, kaufe ich mir noch einen bei ihm. Wie der Kneipen sozialisierte Volksmund weiß, steht es sich auf einem Bein bekanntlich schlecht.
Anschließen versuche ich, mich in der großen Eingangshalle zu orientieren. Ich weiß nicht mehr so genau, wie ich zur Intensivstation komme. Die dunklen, verwinkelten Krankenhausgänge sind aber auch wirklich verwirrend. Glücklicherweise entdecke ich in der Ferne einen Snack-Automaten. An den erinnere ich mich. Dort angekommen, halte ich nach dem nächsten Automaten Ausschau und dann nach einem weiteren. So wie bei Hänsel und Gretel die Brotkrumen, dienen mir die Snack-Automaten als Wegweiser. Zufrieden und satt erreiche ich die Intensivstation.
Fortsetzung (Tag 3, 2/3)
Alle Folgen des Krankenhaus-Blogs:
- Tag 1: Ein kaputtes Herz muss man reparieren
- Tag 2: Don’t go breaking her heart
- Tag 3: Her heart will go on
- Tag 4: Every beat of her heart


Christian Hanne, Jahrgang 1975, hat als Kind zu viel Ephraim Kishon gelesen und zu viel “Nackte Kanone” geschaut. Mit seiner Frau lebt er in Berlin-Moabit, die Kinder stellen ihre Füße nur noch virtuell unter den elterlichen Tisch. Kulinarisch pflegt er eine obsessive Leidenschaft für Käsekuchen. Sogar mit Rosinen. Ansonsten ist er mental einigermaßen stabil.
Sein neues Buch “Wenn ich groß bin, werde ich Gott” ist im November erschienen. Ebenfalls mehr als zu empfehlen sind “Hilfe, ich werde Papa! Überlebenstipps für werdende Väter”, “Ein Vater greift zur Flasche. Sagenhaftes aus der Elternzeit” sowie “Wenn’s ein Junge wird, nennen wir ihn Judith”*. (*Affiliate-Links)
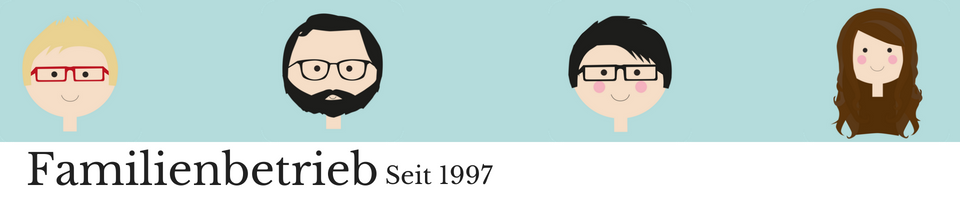
Eintrag „Zivicourage vor dem Snack-Automaten“ gestrichen; neuen Eintrag geschrieben für Twitter; von dem anderen soll nie jemand erfahren.
Ich hasse Dich für diesen Ohrwurm!
💚
Ich drücke Euch die Daumen!
🧡
Spoiler: man bekommt im KH nie das Essen, das man bestellt hat…. Alles Gute weiterhin!
Dann liest du die Blogbeiträge von @Betriebsfamilie und dann hast du ständig was im Auge. ❤️ Maximale Genesung!
Wie geht es euch heute?
Liebe Grüße von der stoffeligen Alachia.
Ich bin wirklich verstört.
Ich umarme Euch, wünsche Euch nur das beste und Deiner Frau eine gute, schnelle und vollständige Genesung <3
Krafttweet 3/3
Weiterhin viel Kraft und Deiner Frau gute Genesung! 💐
Weiterhin alles Gute für deine Frau. Bei so einem Zivi geht es bestimmt rasch aufwärts. 🍀